
In vielen europäischen Ländern findet schon seit Jahren, zumeist national, ein elektronischer Rechnungsaustausch zwischen Auftraggebern und Lieferanten statt. Dabei nutzen die Mitgliedstaaten oft eigene, nationale Datenformate für ihre E-Rechnungen. Um einen reibungslosen E-Rechnungsaustausch auch im EU-Binnenmarkt zu gewährleisten, hat die EU-Kommission das europäische Normungsinstitut CEN mit der Erarbeitung einer europäischen Rechnungsnorm (EN 16931) beauftragt.
Die Veröffentlichung dieser EU-Norm erfolgte am 17. Oktober 2017 im Amtsblatt der Europäischen Union, zeitgleich mit der Veröffentlichung zur Verwendung von zwei alternativen Syntaxen (UN/CEFACT und UBL). Diese Festlegungen schaffen die Voraussetzungen für einen grenzüberschreitenden elektronischen Rechnungsaustausch und die Annahmeverpflichtung für öffentliche Auftraggeber nach der Richtlinie 2014/55/EU.
Spätestens ab dem 18. April 2020 sind öffentliche Auftraggeber verpflichtet, elektronische Rechnungen, die diese Bedingungen erfüllen, anzunehmen und entsprechend zu verarbeiten. Im europäischen Kontext handelt es sich dabei allerdings nur um Auftragsvergaben, die im oberschwelligen Vergabebereich getätigt werden, zum Beispiel Liefer- und Dienstleistungsaufträge über 221 000 Euro.
Umsetzung in den Mitgliedstaaten
Die EU-Rechnungsrichtlinie muss in den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Im Bereich des hier betroffenen Auftragwesens müssen dabei Bund und Länder jeweils eigene Rechtsnormen erlassen. Dies erfolgt in der Regel in zwei Schritten: einer gesetzlichen Regelung (zumeist im E-Government-Gesetz) und einer anschließenden Rechtsverordnung. Dabei stellt sich die Frage, ob die EU-Regelungen 1:1 umgesetzt oder eventuell mit verschärfenden beziehungsweise weitergehenden Bestimmungen versehen werden. In diesem Kontext ist insbesondere zu klären, ob auch der unterschwellige Auftrags-/Vergabebereich bei der E-Rechnung mit einbezogen wird.
Wer ist betroffen?
Im Grunde sind alle öffentlichen Auftraggeber (Paragraf 98 ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB) betroffen. Dies sind neben allen Verwaltungsbehörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene auch kommunale Eigenbetriebe wie etwa Krankenhäuser, Energieunternehmen (Stadtwerke, Abfallwirtschaftsverbände) oder Büchereien.Die gesetzliche Verpflichtung bezieht sich bei den öffentlichen Auftraggebern auf die Annahme und Verarbeitung elektronischer Rechnungen.
Sie kommt quasi einer Garantieerklärung gegenüber den Rechnungsstellern gleich, wonach die Erfüllung aller erforderlichen Rahmenbedingungen (Rechnungsinhalte und Rechnungsformat) verpflichtend ist. Demgegenüber ist eine Verpflichtung gegenüber den Rechnungsstellern zur Erstellung einer elektronischen Rechnung derzeit nur in der E-Rechnungsverordnung des Bundes (Paragraf 3 Abs. 1) ab dem 27. November 2020 vorgesehen.
Elektronische Rechnung
Nach der Definition sowohl der EU-Richtlinie als auch des E-Government-Gesetzes des Bundes und voraussichtlich aller gesetzlichen Regelungen in den Ländern, ist eine „elektronische Rechnung“ eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format (XML-Datei) ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, das ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht. Somit ist nach dieser Definition eine reine Bilddatei (PDF) keine elektronische Rechnung.
Kernelemente einer elektronischen Rechnung
Als Kernelemente einer E-Rechnung werden die Informationsbestandteile bezeichnet, die in einer elektronischen Rechnung enthalten sein müssen, damit sie steuerrechtlich formal gültig ist. Dazu zählen unter anderem die Rechnungsnummer, Informationen über Käufer und Verkäufer, die Zahlungsanweisungen, die Mehrwertsteuer und weitere. Alle Pflichtangaben ergeben sich aus der Mehrwertsteuerrichtlinie (2006/112/EG) beziehungsweise aus Paragraf 14 Umsatzsteuergesetz.
Rechnungsformate
Aus der vom CEN entwickelten europäischen Norm (EN 16931) hat das Steuerungsprojekt des IT-Planungsrats eine nationale Rechnungsnorm für die öffentliche Verwaltung und öffentliche Auftraggeber (XRechnung) erarbeitet, die CEN-konform als nationaler Standard Verwendung findet. Lieferanten können somit davon ausgehen, dass – sollten sie elektronische Rechnungen im Format XRechnung an öffentliche Verwaltungen oder Auftraggeber stellen und diese die übrigen gesetzlichen Anforderungen erfüllen – diese Rechnungen angenommen und verarbeitet werden.
Neben dem Format des IT-Planungsrates besteht in Deutschland noch ein weiteres Rechnungsformat, mit dessen Hilfe elektronische Rechnungen erstellt und ausgetauscht werden können. Dieses Format wurde vom Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) entwickelt und wird als ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) bezeichnet. Bei ZUGFeRD handelt es sich um ein hybrides Format, das aus einer XML-Datei und einem (umhüllenden) PDF besteht.
Vorteilhaft ist, dass der Rechnungsempfänger auswählen kann, welche Version der Rechnung er in seinem Rechnungssystem verarbeiten kann und will. Die Version ZUGFeRD 2.0, die Mitte März 2019 veröffentlicht wurde, hat insgesamt fünf Profile; drei dieser Profile sind in Deutschland als steuerrechtlich vollwertige Rechnungen anerkannt. ÜbertragungswegeDie EU-Rechnungsrichtlinie legt keine Übertragungswege fest, das heißt alle möglichen Varianten z. B. Weberfassung, Webupload, De-Mail, E-Mail oder Webservice sind zulässig. Die tatsächliche Nutzung der entsprechenden Übertragungskanäle erfolgt über ein (Web-)Portal.
Der Bund (https://xrechnung.bund.de) hat, wie auch das Land Bremen (www.e-rechnung.bremen.de), bereits eine Portallösung für einen zentralen Rechnungseingang (ZRE) geschaffen. Andere Bundesländer werden dem Beispiel folgen und ebenfalls Webportale anbieten, auf denen sich die Rechnungssteller (einmalig) registrieren/anmelden müssen (Nutzer-/Servicekonto). Sofern der E-Rechnungsaustausch per E-Mail erfolgt, bieten sich für die zugelassenen Nutzer die Führung einer Black- bzw. Whitelist mit den Namen und E-Maildaten der Lieferanten an.
Leitweg-ID
Um auf den Webportalen eine automatisierte Weiterleitung bzw. Adressierung von E- Rechnungen an die zuständigen Behörden und Dienststellen vornehmen zu können, die als Auftraggeber/Beschaffer diese Leistung oder Lieferung veranlasst haben, ist die Angabe einer Auftrags-/Bestellnummer oder einer anderen eindeutigen Kennzeichnung z. B. einer Leitweg-ID erforderlich bzw. teilweise verpflichtend vorgesehen. Diese Auftragsnummern bzw. die Leitweg-ID werden dem Lieferanten/Auftragnehmer bereits zusammen mit der Bestellung bzw. dem Auftrag mitgeteilt.
Bedeutung für Beschaffungswesen und Einkauf
Soweit die jeweils landesrechtlichen Auftrags- beziehungsweise Vergaberichtlinien für den öffentlichen Auftraggeber (Universitätskrankenhaus oder Kreiskrankenhaus) gelten, müssen sie ab spätestens 18. April 2020 in der Lage sein, elektronische Rechnungen annehmen und verarbeiten zu können. Dabei können die rechtlichen Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland durchaus variieren, etwa in der Frage, ob auch unterschwellige Auftragsvergaben von der E-Rechnungsannahmepflicht erfasst werden. Zudem müssen sich die öffentlichen Rechnungsempfänger auf die Verarbeitung von (reinen) XML-Dateien einstellen.
Das kann über einen elektronischen Workflow in der eigenen Finanzsoftware schnell und fehlerfrei (bei einer Datenübernahme aus der XML-Datei) erfolgen. Grundvoraussetzung für die Funktionssicherheit einer automatisierten Lösung – und damit auch die Akzeptanz – sind neben der jeweiligen IT-Systemlösung insbesondere fehlerfreie Stammdaten. Wie schnell sich im Weiteren ein solcher elektronischer Rechnungsaustausch in der Praxis durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.



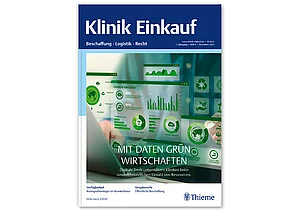
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen