
Die Förderrichtlinie des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) verpflichtet Krankenhäuser, die ihnen bewilligten Mittel vergaberechtskonform zu verwenden. Die Einhaltung der dabei zu beachtenden Regelungen birgt Herausforderungen für Krankenhäuser, die sich bislang nicht oder selten mit Beschaffungen von digitalen Gegenständen beziehungsweise Leistungen befassen mussten. Doch auch die routiniertesten Beschaffer können sich gelegentlich in einer Situation finden, in der Fehler aus alten Vergabeverfahren noch nach Jahren zur Rückforderung von Fördermitteln in Millionenhöhe führen können.
Wer jetzt bei Beschaffungen nachlässig vorgeht, dem droht nicht nur Ungemach aus festgestellten Rechtsverstößen, sondern auch durch hohe Folgekosten. Das schmerzt angesichts der engen Budgets von Digitalisierungsvorhaben, die derzeit mit hohen Kostensteigerungen zurechtkommen müssen.
Krankenhäuser müssen sich wie öffentliche Auftraggeber verhalten
Unabhängig davon, ob Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft an das Vergaberecht gebunden sind oder privat geführt werden: Ausnahmslos alle Kliniken müssen KHZG-Mittel unter Beachtung des Vergaberechts einsetzen. Die Folgen bei Fehlern sind bekannt: Neben Rügen von Marktteilnehmern und Nachprüfungen vor Vergabekammern drohen auch spätere Rückforderungen von Fördermitteln. Vor allem Häuser, die sich bislang wenig mit öffentlichen Vergaben beschäftigen mussten, sind hier gefordert. Solche Krankenhausträger bzw. -gruppen, die Standorte in mehreren Bundesländern betreiben, haben besonders komplexe Beschaffungsverfahren zu durchlaufen.
Die Folgen bei Fehlern sind bekannt: Neben Rügen von Marktteilnehmern und Nachprüfungen vor Vergabekammern drohen auch spätere Rückforderungen von Fördermitteln.
Kreative Abkürzungen der Vergabeverfahren haben Konjunktur Angesichts der aufwendigen Vergabeverfahren gehen einige Kliniken kreative, aber auch abenteuerliche Wege. Dazu gehören „tradierte“ Rahmenverträge, die im jeweiligen Krankenhaus seit Generationen gerne und regelmäßig bei Bestellungen referenziert werden, aber bei einer Überprüfung selbst im Aktenarchiv unauffindbar wären. Es ist nicht unüblich, dass solche Rahmenverträge vor so langer Zeit geschlossen wurden, dass die heutigen vergaberechtlichen Vorgaben nicht berücksichtigt sind oder die Verträge längst hätten neu ausgeschrieben werden müssen. Ein beliebter Ansatz zur „Abkürzung“ von Beschaffungen ist auch die Direktvergabe auf Basis von (vermeintlichen) Alleinstellungsmerkmalen. Tatsächlich zulässig ist das allerdings nur unter sehr strengen Voraussetzungen.
Im KHZG ist eine Vergabe auf Basis von Alleinstellungsmerkmalen sogar fast schon kontraintuitiv, setzt das Förderprogramm doch explizit offene Schnittstellen und Interoperabilität voraus. Umso besser begründet sollten daher Vergabevermerke sein, wenn es zu einer Direktvergabe kommt, oder sogar durch ein unabhängiges externes Fachgutachten untermauert werden. Auch der Weg über einen Beitritt in eine Einkaufsgemeinschaft klingt vielversprechender, als er tatsächlich ist. Der Europäische Gerichtshof hat der allzu laxen Praxis dieser Beschaffungsvehikel Grenzen gesetzt. So lassen sich zwar Beschaffungen mehrerer Häuser effektiv bündeln, um alle damit einhergehenden wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen, jedoch tritt die gewünschte Befreiung von den Regeln des Vergaberechts nicht ohne Weiteres ein.
Vermeintlich clevere Lösungen bergen große Risiken
Die skizzierten Konstellationen lassen erahnen, dass der vermeintlich einfachere Weg, Leistungen zu beauftragen, nicht auch der sicherere ist. Nachlässigkeiten oder übertriebene Bauernschläue in der Vergabe bringen dem Krankenhaus große wirtschaftliche Risiken ein, die zudem noch lange Zeit nach der Projektumsetzung schlummern. Dabei muss bedacht werden, dass es im Rahmen des KHZG gleich mehrere mögliche Anlässe gibt, das Beschaffungswesen auf den Prüfstand zu stellen (siehe Kasten).
KHZG – Beschaffung auf dem Prüfstand:
•durch Rügen von unterlegenen oder nicht bedachten Marktteilnehmern
•durch Nachprüfungen vor Vergabekammern
•im Rahmen des Zwischenverwendungsnachweisverfahrens
•durch Zwischenprüfungen der Länder
•im Rahmen des Schlussverwendungsnachweisverfahrens
•durch Nachfragen des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS)
Da die Fördermittel immer unter Vorbehalt der Rückforderung stehen, können Fehler bei der Vergabe noch lange nach Projektumsetzung dazu führen, dass die Fördersumme jedenfalls in Teilen zurückgezahlt werden muss. Nachträglich heilen lassen sich Vergabeverstöße in diesem Kontext nicht, und da es sich um zwingende gesetzliche Vorgaben handelt, sind sie auch nicht im politischen Raum verhandelbar. Die wirtschaftliche Lage von Krankenhäusern hin oder her: Wenn das Vergaberecht nicht eingehalten wurde, hilft auch die beflissentliche Erfüllung aller Muss-Kriterien der Förderrichtlinie am Ende nicht mehr.
Beschaffungswesen in Digitalisierungsprojekte einbinden
Bereits im Normalfall sind die Vergabeverfahren nicht trivial und erfordern Trittsicherheit. Speziell im KHZG sind zudem Know-how zu Hardware, Software und IT-Dienstleistungen sowie der Fördermittelrichtlinie nötig, um Beschaffungen präzise und erfolgreich zu gestalten. Dass sich digitale Produkte nicht genauso beschaffen lassen wie Bauleistungen und medizinisches Verbrauchsmaterial, ist in der Krankenhausbranche bekannt. Es handelt sich bei digitalen Produkten eben um einen grundlegend anderen Gegenstand, sodass eine Vielzahl von funktionellen und vertraglichen Fallstricken zwingend zu beachten sind.
Im KHZG kommt nun mindestens eine Ebene der Komplikation durch die Vorgaben des Förderprogramms hinzu. Ungelöst bleibt allerdings allenthalben die Herausforderung, eine pragmatische, aber präzise vergaberechtliche Expertise mit einer verständigen und anschlussfähigen Expertise aus der Anwendersicht der Digitalisierungsprojekte zusammenzubringen. Fachleute beider Bereiche sind rar, doch genau zwischen diesen Perspektiven befindet sich eine Lücke, die im Projektverlauf für viele und teure Missverständnisse und unnötige Komplikationen ursächlich ist.
Hastige Entscheidungen und Inseloptimierungen vermeiden
Die Konstruktion aus „Zuckerbrot und Peitsche“ kann bereits jetzt als Erfolg des KHZG verbucht werden. Über 6000 Förderanträge sind eingegangen. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass Krankenhäuser die Mittel genau deswegen mit einer gewissen Hektik und opportunitätsgetrieben ausgeben – also vor allem mit Blick auf Anbieter, mit denen sie schon zusammenarbeiten, die leicht verfügbar scheinen oder zeitnah lieferfähig sind. Manchmal spielen auch Eigeninteressen der Institute bzw. Fachbereiche eine dominante Rolle. In solchen Fällen haben sich bei der Antragstellung bzw. Mittelallokation die Abteilungen durchgesetzt, die sich am lautesten im internen Diskurs bemerkbar machten und nicht die, die am besten geplant oder den höchsten Digitalisierungsbedarf haben.
An dieser Stelle macht der Vergleich mit Bauprojekten durchaus Sinn: Ohne klaren Bauplan entsteht teurer Murks, der in Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung unnötig hohe Kosten verursacht.
In der Konsequenz werden einzelne Bereiche mit teurer Technologie ausgestattet, aber das Krankenhaus insgesamt verharrt auf einem niedrigen digitalen Reifegrad. Solche Konstellationen deuten darauf hin, dass es der Gesamtorganisation an einer Vision und Strategie für die Digitalisierung fehlt und sie Investitionen nicht zielgenau lenkt. Die Folge sind Inseloptimierungen. Um wirkungsoptimiert investieren zu können, müssen zunächst Ausrichtung und Architektur der Digitalisierung klar definiert sein. Diese Definitionen dienen als Leitplanken für alle Projekte und Beschaffungen. An dieser Stelle macht der Vergleich mit Bauprojekten durchaus Sinn: Ohne klaren Bauplan entsteht teurer Murks, der in Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung unnötig hohe Kosten verursacht.
Das Marktumfeld für Beschaffungen ist ungünstig
Die Kostenplanung der KHZG-Projekte stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Dass eine gestiegene Nachfrage auf dem überschaubaren Markt für Krankenhaus-IT die Preise steigen lässt, war erwartbar, ebenso der Mangel an Fach- und Führungskräften, die Krankenhäuser von der Papierakte in die digitale und vernetzte Welt begleiten können. Weniger erwartbar war, dass der Verwaltungsaufwand für die Mittelbewilligung so hoch ist, dass Anfang 2023 noch nicht alle Bescheide für Vorhaben vorliegen, die eigentlich Ende 2024 schon realisiert sein sollen. Völlig unerwartet in der Härte war jedoch der Einschlag der Energiepreissteigerung und der Inflation, die nicht nur die Angebotspreise weiter steigen lässt, sondern auch zur massiven Abschmelzung der Krankenhaus-Eigenmittel führt. So ist der Manöverraum für Zuschüsse und Goldrandlösungen – aber eben auch um Fehler bei der Vergabe und Vertragsgestaltung auszugleichen – schlagartig kleiner geworden.

Eine andere Facette des vergleichsweise kleinen Marktes der Krankenhaus-IT ist die Reife der Anbieter hinsichtlich ihrer eigenen Organisation und Produktentwicklungsprozesse. Deutlich wird das am Beispiel der Informationssicherheit: Krankenhäuser wurden in den letzten Jahren zunehmend dazu verpflichtet, ihr Niveau an Informationssicherheit anzuheben. Es begann mit den KRITIS-Häusern (Paragraf 8a des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSIG) und umfasst inzwischen jedes Krankenhaus in Deutschland (Paragraf 75c Sozialgesetzbuch V). Völlig begründet und nachvollziehbar drängen nun die Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) bzw. Chief Information Security Officer (CISO) darauf, bereits in der Beschaffung darauf zu achten, dass ein Hersteller bzw. Dienstleister seinerseits ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) betreibt und das auch durch ein Zertifikat nachweisen muss.
So ist der Manöverraum für Zuschüsse und Goldrandlösungen – aber eben auch um Fehler bei der Vergabe und Vertragsgestaltung auszugleichen – schlagartig kleiner geworden.
Die Praxis zeigt jedoch, dass die wenigsten Unternehmen auf dem Krankenhausmarkt diese Nachweise erbringen können. Das lässt Krankenhäuser in der Beschaffung in einem Dilemma: Sie können aus einer eher kleinen und somit erwartbar teuren Auswahl an potenziellen Anbietern wählen, die ihre Informationssicherheit nachweisbar im Griff haben, oder müssen nach einer Hard- oder Softwarebeschaffung auf eigene Kosten noch ein IT-Sicherheitsniveau für das Produkt des bezuschlagten Lieferanten herstellen oder zumindest dokumentieren.
Fazit
Das KHZG hat Bewegung und gleichzeitig Dehnungsschmerz an vielen Stellen im Krankenhauswesen ausgelöst. Die Einkaufsabteilungen bilden dabei keine Ausnahme. Nachdem das aufwendige behördliche Bewilligungsverfahren im KHZG einen wesentlichen Teil der Zeitschiene bereits verzehrt hat, ist der Druck auf die Beschaffungsprozesse dementsprechend hoch, um jetzt schnell die Wünsche der Anforderer zu erfüllen. Doch genau in dieser Situation muss davor gewarnt werden, zu schludern. Aus Nachlässigkeit oder Unkenntnis bei der Regulatorik im Vergabeverfahren können kaufmännische und regulatorische Risiken für das Krankenhaus erwachsen, die bis zur Rückzahlung der KHZG-Fördermittel führen können, während ein gleichzeitig unbedacht geschlossener Vertrag weiterhin über Jahre empfindlich zu Buche schlägt.


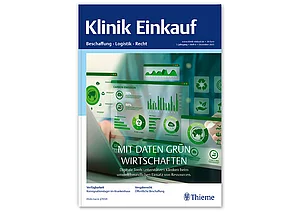
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen