
In den ersten Jahren nach der Einführung des DRG-Systems konnten Krankenhäuser ihre finanzielle Lage mit simplen betriebswirtschaftlichen Basisrezepten stabilisieren: Spezialisieren, Fallzahlen steigern, Kapazitätsauslastung erhöhen, Kostensteigerungen vermeiden. Derzeit dreht sich aber der Wind: Die Regierung lässt Konzepte erarbeiten, wie Krankenhäuser für gute Qualität finanziell belohnt werden können. Schlechtere Qualität kann dazu führen, dass Leistungen nicht mehr angeboten oder abgerechnet werden dürfen.
Mindestmengenvorschriften und Zentrenbildung
Mindestmengenvorschriften und Zentrenbildung sind weitere Stichworte, die belegen, dass nur ein konsequentes Qualitätsstreben die betriebswirtschaftliche Zukunft von Krankenhäusern sichert.Eine ähnliche Diskussion gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Schon im Jahr 2000 hat eine berühmte Studie mit dem Titel „To err is human“ in den USA eine breite Welle von Qualitäts- und Risikomanagement-Aktivitäten ausgelöst. International wird heute von Value Based Healthcare (VBHC) gesprochen.
Dieser Oberbegriff entspringt der so genannten Value Agenda der Harvard Business School (Schlüsselautor Michael Porter). Darin wird das Ziel verfolgt, patientenrelevante Outcomes konsequent in den Mittelpunkt aller Krankenhaus-Aktivitäten zu stellen, und auch die Vergütung daran auszurichten. Erreicht werden soll dies u. a. durch einen Mix aus Integration verschiedener Fachdisziplinen, Wachstum durch Spezialisierung und Konzentration von Leistungen.
Auch wenn dieses Konzept insgesamt zu komplex ist, um es schnell umzusetzen, gibt es doch in fast allen hochentwickelten Gesundheitssystemen eine breite Diskussion, in welchen Schritten eine praktische Einführung möglich ist.
Qualität und Kosten sind nicht immer ein Gegensatz
Für den Einkauf ist es ganz wichtig, sich aktiv an dieser Diskussion zu beteiligen und einen eigenen Beitrag in Richtung Value (Wertschöpfung) zu erbringen. Natürlich hat sich der Krankenhaus-Einkauf schon immer im Spannungsfeld von Qualität und Kosten bewegt („der Ferrari ist halt teurer als der Fiat“). Mit der neuen Qualitätsoffensive muss sich der Einkauf aber auf ein neues Level begeben. Die wissenschaftliche Literatur hat vor kurzem begonnen, diese Herausforderung unter dem Stichwort „Value Based Procurement“ (wertschöpfungsorientierter Einkauf) zu diskutieren.
Auch in der Praxis ist das Thema längst angekommen. Vor einiger Zeit hat das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen Krankenkassen gerügt, weil sie bei Ausschreibungen für Inkontinenzprodukte zu einseitig auf den Produktpreis abgestellt haben. Dies kann auf zweierlei Weise zu komplett falschen Entscheidungen führen. Zum einen ist es durch die Sozialgesetzgebung nicht gedeckt, minderwertige Produkte und damit schlechte Versorgungsqualität zu dulden. Zum anderen geht es ja nicht um die Kosten pro Produkteinheit, sondern um die Kosten pro versorgtem Patienten.
Wenn man die Windelwechsel mit einkalkuliert, erscheinen Billigprodukte sofort in einem ganz anderen Licht. Bislang fehlt es an einem durchgängigen Konzept, an welchen Kriterien sich der Einkauf bei der Auswahl von Produkten und Lieferanten orientieren kann, um die „richtige Qualität“ zu finden. Wertschöpfung bedeutet, die Veränderung des Gesundheitszustandes eines Patienten in den Mittelpunkt zu rücken. Das erfolgt über den klassischen Dreiklang aus Potenzialen, Prozessen und Ergebnissen. Letztere sind aber nicht nur aus der Perspektive der Medizin (harte Endpunkte), sondern auch der Patienten (weiche Endpunkte) zu messen.
Innovationsfähigkeit des Systems nicht aus den Augen verlieren
Zudem idealerweise nicht nur direkt nach einer Intervention, sondern auch mit einer nachhaltigen zeitlichen Perspektive (etwa bei Implantaten).Nicht selten muss der Bezugsrahmen aber noch weiter gefasst werden. Sollte ein Billigprodukt zu erhöhtem Zeitaufwand beim Personal führen und/oder Reputationsschäden bei einem Leistungserbringer oder dessen Stakeholdern hervorrufen, war die Auswahlentscheidung vermutlich falsch.
Am Ende geht es gerade in der Gesundheitswirtschaft immer auch darum, die Innovationsfähigkeit des gesamten Systems und damit Folgewirkungen für die Gesellschaft insgesamt nicht aus den Augen zu verlieren.Bei ihrer täglichen Arbeit brauchen Einkäufer natürlich etwas konkretere Vorgaben. Der Medizinbetrieb orientiert sich bei der Messung und Beurteilung von Ergebnissen schon reflexartig an den Erfordernissen der evidenzbasierten Medizin als Goldstandard. Gefordert werden also doppelt verblindete und randomisierte klinische Studien.
Studien auch für Beschaffungsentscheidungen wichtig
Wenn es solche Studien für Medizinprodukte gibt, kann das auch für Beschaffungsentscheidungen sehr hilfreich sein. Das ist aber die Ausnahme. Stets hilfreich ist es dagegen, konsequent die Kosten pro Patient im Blick zu haben. In Schweden hat man vor einigen Jahren eine Ausschreibung für Verbandsmaterial so formuliert, dass die Bieter für fiktiv vorgegebene Patientenkategorien die Tageskosten pro versorgtem Patienten vorlegen mussten. Ersatzweise sollten Befragungen von Patienten und Nutzern für Produktauswahlentscheidungen herangezogen werden.
Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, von den Lieferanten zu fordern, sich an Initiativen beispielsweise zum ressourcenschonenden Einsatz der Produkte zu beteiligen oder Risiken für Folgekosten mitzutragen. Eine kanadische Provinzregierung hat im Jahr 2014 einen Auftrag für kardiologische Produkte an den Anbieter vergeben, der bereit war, die Kosten zu tragen, wenn die Produkte unterhalb der angegebenen Lebensdauer blieben.
Herausforderung und Chance zugleich
In Workshops mit Krankenhauseinkäufern haben wir einige Beispiele aus der täglichen Praxis genannt bekommen (siehe Grafik). Es zeigt sich, dass die Grundkonzeption des wertschöpfungsorientierten Einkaufs den Praktikern durchaus vertraut ist. Die Workshops haben aber zugleich belegt, dass eine konsequente Anwendung auf möglichst viele Warengruppen noch aussteht.Die Orientierung an der Wertschöpfung ist für den Klinik-Einkauf Herausforderung und Chance zugleich. So brauchen Einkäufer den interdisziplinären fachlichen Austausch mit den Anwendern, um eine Orientierung am Patientennutzen zu erreichen.
Außerdem können Einkäufer auf diese Weise nicht nur die Qualitätsstrategie ihres Hauses unterstützen, sondern auch den eigenen Stellenwert im Haus stärken.



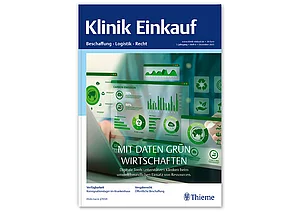
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen