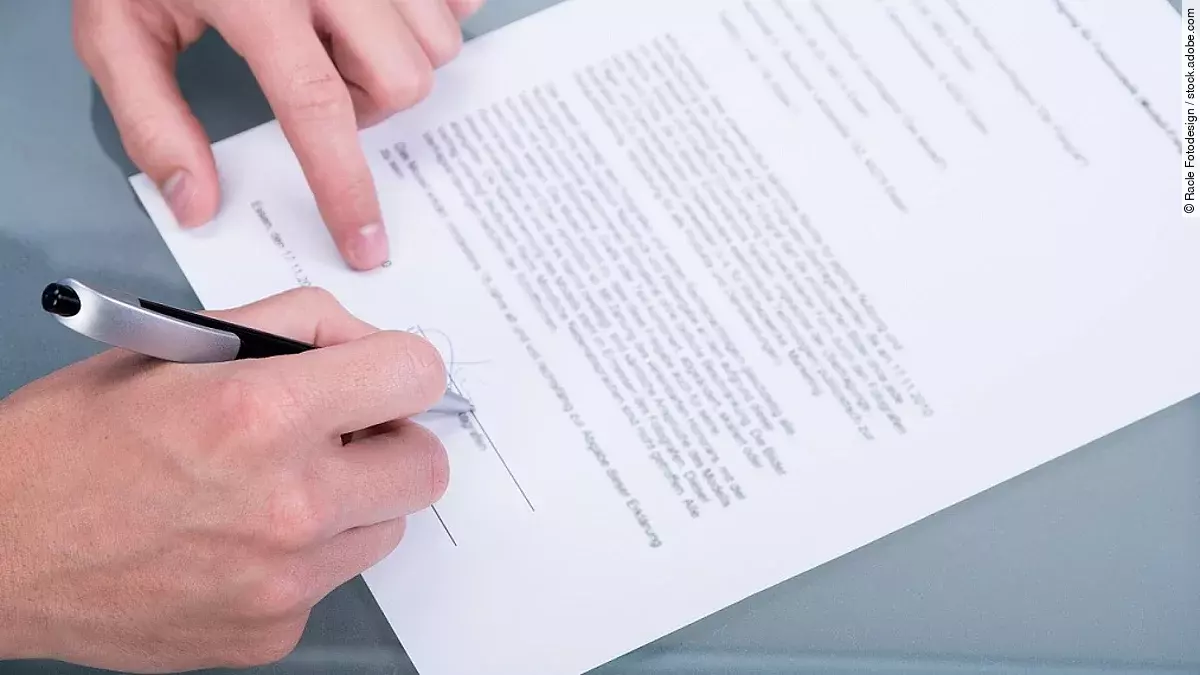
Die Corona-Zeit hat viele Verhandlungen zwischen Krankenhäusern und Lieferanten in den digitalen Raum verlagert. Zoom, Teams oder ähnliche Systeme gehören heute zum Standardrepertoire des Einkaufs. Die jeweiligen Vor- und Nachteile im Vergleich von digitalen und klassischen, analogen Verhandlungen sind weitgehend ausgeleuchtet. Es stellt sich aber die Frage, ob Zoom & Co. vielleicht nur ein Zwischenschritt auf dem Weg der digitalen Transformation von Verhandlungen aller Art sind. Möglicherweise können menschliche Entscheider ja noch bei weiteren Prozessschritten des Verhandelns von intelligenter Software unterstützt werden.
Das übergeordnete Ziel: Transaktionskosten senken
Zoom & Co. haben uns allen – ob freiwillig oder unfreiwillig – vor Augen geführt, worin die enormen Vorteile einer Digitalisierung liegen: keine Reisezeiten und -kosten, viel bessere Nutzung von ggf. unvermeidbaren Wartezeiten, schnelle Kontaktaufnahme und vieles mehr. Allgemein können wir von einer Senkung der sogenannten Transaktionskosten sprechen. Bei konventionellen Verhandlungen, Face-to-Face zwischen menschlichen Akteuren, gibt es aber auch unschätzbare Vorteile: Menschliche Interaktionen wie Gestik, Mimik oder Stimmungen können viel besser wahrgenommen und interpretiert werden. Soziale Normen fordern die scheinbare oder tatsächliche rationale Rechtfertigung subjektiver Ansprüche. Allein mit Fakten wird kaum eine Verhandlung erfolgreich zu Ende geführt. Die für geschäftliche Transaktionen so wichtige Vertrauensbildung erscheint vielen ohne persönliche Kontakte nur schwer zu realisieren. Ein oft gehörtes Fazit lautet daher: Für Erstkontakte braucht man den direkten persönlichen Kontakt mit der Gegenseite, Videokommunikation ist nur für Folgeverhandlungen zu empfehlen.
Drei Bereiche der Verhandlungen:
- Informationsübermittlung
- Nutzeneinschätzung
- Dokumentenmanagement
Potenziale digitaler Verhandlungsunterstützung – synchron vs. asynchron
Es gibt aber schon heute interessante Beispiele, wie digitale Tools dem Menschen noch viel mehr Unterstützung bieten können als Zoom & Co. Zudem steht zu erwarten, dass mit dem rasanten Vordringen von Large Language Models wie ChatGPT die Mächtigkeit solcher Systeme mithilfe von künstlicher Intelligenz gesteigert werden kann. Aus heutiger Sicht gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen, asynchrone und synchrone elektronische Verhandlungen. Bei der synchronen Variante verhandelt ein Mensch mit einem Avatar, also einer Maschine. Beispielsweise entstehen an der Universität Enschede und an der Hochschule Neu-Ulm (beat the Bot) gerade Systeme mit einem solchen Setting. Auf beiden Seiten gibt es Algorithmen zur Risikoanalyse, für Kostenberechnungen und Lieferantenbewertungen. Die konkreten Einsatzmöglichkeiten erscheinen derzeit allerdings lediglich für Schulungszwecke geeignet. Einkäufer oder Verkäufer trainieren mit dem Roboter, vergleichbar mit einem Flugsimulator für Piloten. Beide Seiten arbeiten mit natürlicher Sprache, der Mensch wird mit Mitteln der virtuellen Realität in eine digitale Welt hineingezogen (Immersion). Wie im sogenannten Metaverse soll idealerweise das Bewusstsein des Menschen durch illusorische Stimuli so weit beeinflusst werden, dass es in der menschlichen Wahrnehmung kaum noch Unterschiede zwischen der realen und der digitalen Welt gibt. Aufgrund der asymmetrischen Konstellation (Mensch vs. Maschine) erscheint diese Herangehensweise aber zunächst primär für Schulungszwecke geeignet.
Digitale Unterstützung für asynchrone Verhandlungen
Eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen praktischen Einsatz haben Systeme für asynchrone Verhandlungen (z. B. Negoisst von der Universität Hohenheim). Auf den allerersten Blick geht es dabei um einen angereicherten E-Mail-Verkehr, der allerdings das Potenzial bietet, heute gängige Prozessschritte in Verhandlungen zwischen Einkauf und Vertrieb wirksam digital zu unterstützen. Um es gleich vorwegzunehmen: Auch hier gilt: Unterstützung menschlicher Entscheider, nicht Substitution. Um dies zu realisieren, empfiehlt sich die Einteilung von Vertragsverhandlungen in die drei Bestandteile Information, Präferenzeinschätzung und Dokumentenmanagement (für Verträge). Aus anderen Bereichen ist hinlänglich bekannt, dass digitale Technologien diese drei Bereiche unterstützen können. Für Verhandlungen braucht es aber eine spezielle Konfiguration:
Information und Kommunikation
In jeder Verhandlung gibt es formelle und informelle Kommunikationsanteile. Zu ersteren zählen Formate wie Angebot, Gegenangebot, Rückweisung eines Angebotes, Rückfragen oder Annahme eines Angebotes. Weitere formelle Bestandteile sind Fakten wie Preis, Menge, Lieferfrist u. a. Die informellen Teile übernehmen quasi das „Feilschen“ aus analogen Verhandlungen. Da die Kommunikation in natürlicher (geschriebener) Sprache erfolgt, wird Software eingesetzt, die Themen und Werte identifiziert und gesondert am Bildschirm darstellt. Es gibt also einen semi-strukturierten Informationsaustausch. Verbindliche Felder nehmen die formellen Bestandteile einer Verhandlung auf. In dem rein kommunikativen Teil ist Platz für Argumente, Erklärungen, ggf. auch Drohungen oder Verlockungen. Diese vom Rechner auswerten zu lassen, erfordert allerdings eine solide theoretische Grundlage.
Entscheidungsunterstützung durch Präferenzeinschätzungen
Verkäufer und Käufer stehen in jeder Phase einer Verhandlung vor der Herausforderung, den jeweiligen Stand der Konditionen vor dem Hintergrund der eigenen Nutzenfunktion zu bewerten. Nur in Situationen, in denen „alles andere ausverhandelt“ ist, erfolgt die Präferenzeinschätzung alleine durch den Preis. Deutlich häufiger und wichtiger sind Situationen mit mehrdimensionalen Zielfunktionen. Dies kann im Einzelfall eine Komplexität annehmen, die vom Menschen allein nicht mehr komplett überblickt werden kann. Auch dazu gibt es aber erprobte Softwaresysteme zur Unterstützung. Wenn die Nutzenkriterien zuvor eindeutig angegeben werden können, wird der Nutzer aufgefordert, seine Gewichtungen für die Teilkriterien wie in einem Scoring-Modell anzugeben. Alternativ gibt es auch den Weg, dem Entscheider Alternativ-Bündel zu präsentieren und diese in eine Reihenfolge der Vorziehenswürdigkeit zu bringen (Conjoint-Analyse). In jeder Phase der Verhandlung wird dem menschlichen Entscheider dann angezeigt, auf welchem Nutzenlevel sich die jeweiligen Angebote und Gegenangebote gerade befinden. Es ist aber anzunehmen, dass insbesondere dieser Teil solcher Systeme eine intensive Schulung der Anwender voraussetzt. Zudem geht es in realen Verhandlungen ja oftmals genau darum, der Gegenseite etwas zu bieten, was für diese von großem Nutzen ist, von dem Anbietenden aber ohne große Schmerzen zugesagt werden kann. Nach jetzigem Entwicklungsstand sieht jede Seite nur die eigene Nutzenfunktion, nicht die der Gegenseite. Allerdings ist klar festzuhalten, dass Auktionen eine harte Belastung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Kunden darstellen.
Dokumentenmanagement
Der von vielen Beteiligten als lästigste Teil einer Verhandlung angesehene letzte Schritt ist das Erstellen eines Vertrags inkl. dem Management unterschiedlicher Dokumentenversionen. Es erscheint unmittelbar einsichtig, dass gerade auch bei dieser Aufgabe die Maschine ausgesprochen hilfreich sein kann. Die Software erstellt automatisch zu jeder aktuellen Konstellation von Angebot und Nachfrage eine Vertragsvariante und kann dabei auch auf eine eigene Bibliothek zurückgreifen. Konfliktvermeidend wirkt dabei, dass im Vertragsentwurf ersichtlich ist, auf wessen Vorschlag eine bestimmte Regelung zustande gekommen ist.
Unterschiede zu elektronischen Auktionen und Software-Agenten
Die oben dargestellten digitalen Unterstützungssysteme für Verhandlungen zielen darauf ab, für komplexe Verhandlungsgegenstände und Kommunikationen zwischen heterogenen Partnern eingesetzt zu werden. Sie sind damit konzeptionell anders ausgelegt als Auktionen oder Agenten. Die Stärke von Auktionen liegt darin, für gut spezifizierbare Leistungen eine hohe Wettbewerbsintensität zu erzeugen, von der die jeweils andere Partei profitiert. Allerdings ist klar festzuhalten, dass Auktionen eine harte Belastung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Kunden darstellen. Software-Agenten werden verwendet, um ein Matching zu unterstützen, also z. B. neue Lieferanten im Internet für ausgewählte Güter zu finden, oder Lieferantenbewertungen zu erstellen. Auch diese digitalen Anwendungen sind praktisch hoch relevant, eignen sich aber für viele Aufgaben im Krankenhauseinkauf nicht.
Fazit
Verhandlungen lassen sich ganz allgemein in drei Bereiche aufteilen: Informationsübermittlung, Nutzeneinschätzung und Dokumentenmanagement. Es erscheint plausibel, dass mit steigender Komplexität der menschliche Entscheider gut beraten ist, sich von digitalen Tools unterstützen zu lassen. Derzeit befinden sich Systeme zur digitalen Verhandlungsunterstützung allerdings noch nicht in der flächendeckenden praktischen Anwendung. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein, ob es den Systemen gelingt, benutzerfreundlich zu sein und die Lebensrealität von Einkäufer und Verkäufer zu treffen. Bei Zoom & Co. gab es einen externen Schock, der zur flächendeckenden Anwendung geführt hat. Dies wird sich hoffentlich in dieser Form nicht wiederholen. Der Einkauf ist aber gut beraten, die weitere Entwicklung dieser Systeme für elektronische Verhandlungen zu verfolgen. Anders als bei Auktionen beispielsweise können beide Seiten von einer Senkung der Transaktionskosten profitieren, ohne das Vertrauen in die Gegenseite zu verlieren.



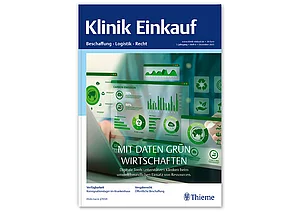
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen