
2023 war herausfordernd für die deutsche Diagnostik-Industrie: Die Umsätz gingen um 36 Prozent auf insgesamt 2,33 Milliarden Euro zurück. Ursächlich hierfür? Das Segment der Corona-Diagnostik hatte keinen wesentlichen Einfluss mehr. Mit einem Rückgang von fünf Prozent entwickelte sich aber auch die Routinediagnostik nur verhalten.
„Die Diagnostika-Branche hat im Jahr 2023 einen entscheidenden Wendepunkt erlebt. Trotz eines erwarteten Rückgangs im Marktwachstum sehen wir nun die Gelegenheit, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen und dabei die nachhaltige Entwicklung und Sicherstellung der Fachkräfteversorgung in den Vordergrund zu rücken“, so der VDGH-Vorsitzende Ulrich Schmid.
Wir sehen nun die Gelegenheit, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen.
Steigende Umsätze erwartet
Trotz dieser Zahlen zeigt sich die Branche hinsichtlich der Umsätze für das laufende Jahr optimistisch, wie aus einer Befragung des Verbands der Diagnostica-Industrie (VDGH) hervorgeht. Demnach gehen 60 Prozent der Unternehmen von steigenden Umsätzen aus. Die Stimmung ist dennoch ambivalent: 46 Prozent bewerten die wirtschaftliche Situation positiv, 19 Prozent schlecht/sehr schlecht und 35 Prozent zeigen sich zufriedenstellend. Gründe sind laut VDGH-Vorsitzenden Ulrich Schmid vor allem Kostensteigerungen über die ganze Bandbreite — Rohstoffe, Energie, aber auch höhere Tarifabschlüsse für Gehälter.
Wir leiden massiv unter dem Fachkräftemangel.
Insgesamt gibt es einen positiven Trend bei den Beschäftigten. Zumindest 47 Prozent der Unternehmen gaben eine gleichbleibende Entwicklung an. 37 Prozent verzeichneten ein Wachstum bis fünf Prozent, 4,6 Prozent der befragten Unternehmen konnten sogar ein höheres Wachstum vorweisen. Ein Kernproblem macht jedoch auch vor der Diagnostikbranche keinen Halt: „Wir leiden massiv unter dem Fachkräftemangel. Das ist wenig überraschend, weil es ein genereller Trend in allen Sektoren ist“, so Schmid. Trotz der teils positiven Entwicklung im Bereich der Beschäftigtenentwicklung leiden fast 94 Prozent der Unternehmen unter dem Fachkräftemangel – vor zehn Jahren waren es noch knapp 35 Prozent. Zwar würden auch viele Unternehmen aus ausbilden, um die offenen Positionen zu besetzen, den Bedarf decken würde es aber nicht, ergänzt Schmid.
Stärken und Schwächen
Die Innovationsbereitschaft bleibt stabil. So gaben 60 Prozent an gleichbleibend zu investieren, 30 Prozent erhöhen die Investitionen und elf Prozent verringern die Investitionen. „Das sind aus unserer Sicht sehr gute Werte“, so Schmid. Zudem würden drei Viertel der Unternehmen neue Produkte einführen – wobei sie jedoch auf regulative Hürden stoßen. Diese seien auch der größte Bremser für die Branche, gefolgt von steigenden Kosten und dem Preisdruck am Markt. Weiter hinten auf Rang 6 ist die Bürokratie, die erstmals in der „Bremserstatistik“ auftaucht, sagt Schmid.
Abgefragt wurden auf der anderen Seite auch die Stärken des Standortes Deutschland: als Stärke Nr. 1 wurde die Qualifikation der Beschäftigten angegeben. Auch das Versorgungsniveau der Patientinnen und Patienten ist hoch. Immer noch im Ranking aber mit fallender Relevanz sind ein stabiles wirtschaftliches Umfeld und der hohe Standard der klinischen Forschung.
„Wir sind eine Branche, die gewohnt ist im schwierigen Fahrwasser umzugehen“, so Schmids Resümee der VDGH-Umfrage. Für das laufende Jahr sehe der Verband gute Entwicklungschancen.
Wir erleben einen Paradigmenwechsel in der gesundheitspolitischen Landschaft.
Dr. Martin Walger, VDGH-Geschäftsführer, unterstreicht die Potenziale, welche die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz für die Labordiagnostik darstellen. Aus Sicht des Verbandes ist die digitale Transformation eine Chance, die Effizienz der medizinischen Versorgung zu steigern und gleichzeitig die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Diagnostika-Industrie zu stärken.
„Wir erleben einen Paradigmenwechsel in der gesundheitspolitischen Landschaft. Die Erkenntnis ‚Daten helfen heilen‘ ist durch die im Februar verabschiedeten Digitalgesetze untermauert. Die Digitalisierung des Gesundheitssystems wird konkret. Die Diagnostika-Industrie und die ärztlichen Labore können hierzu maßgebliche Beiträge liefern“, sagt Walger.
Wie wichtig die Digitalisierung für die IVD-Produkte ist, zeigen auch die Ergebnisse der Umfrage. 66 Prozent gaben an, dass die Digitalisierung eine hohe (zukünftige) Bedeutung in den Produkten habe, 30 Prozent stuften diese als gering ein und vier Prozent niedrig.
Herausforderungen und Chancen
Trotz der positiven Perspektiven steht die Branche vor unverminderten Herausforderungen, insbesondere bei der Umsetzung der neuen regulatorischen Rahmenbedingungen. Diese sind europaweit in der In-vitro-Diagnostika-Verordnung (IVDR) festgelegt. Der VDGH begrüßt den aktuellen Vorschlag der EU- Kommission zur Verlängerung der Übergangsfristen um 2,5 Jahre. Damit kann drohenden Versorgungsengpässen in der Labordiagnostik entgegengetreten werden. Denn ohne Verlängerung wäre es vor allem im Bereich der Klasse-D-Produkte kritisch. Von diesen waren im Oktober 2023 erst 14 Prozent in den neuen Rechtsrahmen transferiert, berichtet Walger.
Langfristig sind jedoch grundsätzliche Anpassungen des Rechtsrahmens erforderlich. Die EU-Kommission wird noch in diesem Jahr eine Evaluierung der IVDR starten. Der VDGH hat bereits im Herbst 2023 zusammen mit dem Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) ein Whitepaper zur Weiterentwicklung vorgelegt.



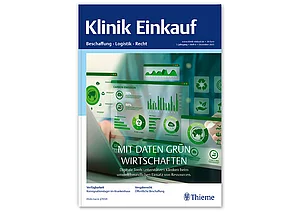
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen