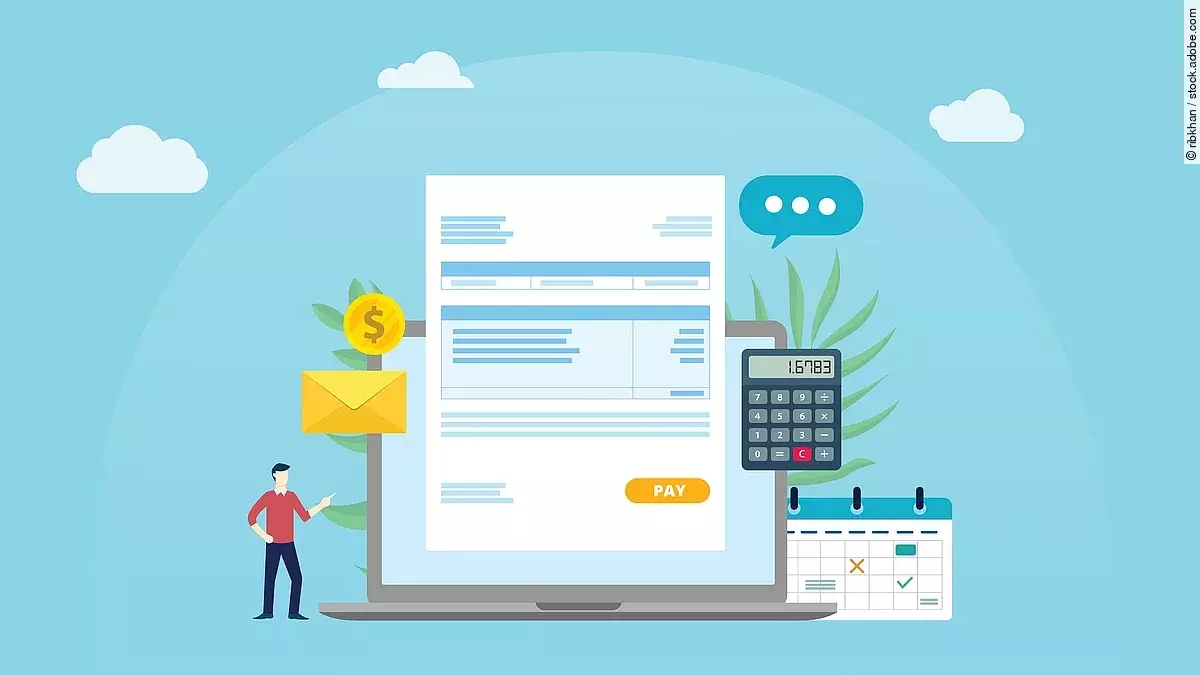
Mit dem Wachstumschancengesetz wird die elektronische Rechnung in Deutschland ab 2025 schrittweise zur Pflicht. Was im ersten Schritt als Mammutaufgabe erscheint, ist ein wichtiger und richtiger Schritt für die Digitalisierung in Deutschland. Beide Seiten profitieren hier: mehr Transparenz für die Finanzbehörden, aber auch handfeste Vorteile für die Wirtschaft, denn ein manuelles oder teilautomatisiertes Erfassen von Rechnungen fällt weg.
Hintergründe – So neu ist das Thema nicht
Das Thema elektronische Rechnung ist nicht neu, bereits Anfang der 70er-Jahre wurden Rechnungsdaten in einem strukturierten Format ausgetauscht, gefolgt von der breiten Einführung von EDI (Electronic Data Interchange) in vielen Branchen in den 80er- und 90er-Jahren. Überall, wo große Volumina anfallen und auf einheitliche Standards gesetzt wurde, ist EDI und damit die elektronische Rechnung ein Erfolgsfaktor für viele Branchen. Die größte Community für EDI basiert auf dem GS1 Standard EANCOM®. Hier gibt es entsprechende Profile für verschiedene Branchen, u. a. für das Gesundheitswesen.
Da EDI jedoch primär in den Bereichen zum Einsatz kommt, in denen Prozesse vollständig automatisiert werden sollen, gibt es hier Grenzen. Hier kam dann vor zehn Jahren ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) ins Spiel, überall wo noch Papier und reine PDF-Rechnungen gesendet wurden, kann das hybride Format eingesetzt werden. Branchenübergreifend entwickelten Experten ein gemeinsames Datenmodell für eine Kernrechnung, um Rechnungsprozesse außerhalb von EDI zu optimieren.
Das bisherige Anrecht auf eine Papierrechnung des Empfängers entfällt.
Das Thema elektronische Rechnungen wurde aber auch in der Politik vorangetrieben. Die EU-Kommission sieht E-Rechnungen als Schlüsselfaktor für die Digitalisierung in Europa. Hierzu passte sie schrittweise die umsatzsteuerrechtlichen Rahmenbedingungen an und schaffte die digitale Signatur als Umsetzungshindernis ab.
Der nächste Hebel in der EU war die öffentliche Verwaltung; hier wurden alle öffentlichen Institutionen in der Europäischen Union verpflichtet, elektronische Rechnungen anzunehmen. Einige Länder verknüpften dies mit einer Verpflichtung für ihre Lieferanten. Damit dies funktioniert, wurde das europäische Normungsgremium CEN beauftragt, ein einheitliches Format zu schaffen – die europäische Kernrechnung EN 16931.
Die nächste Stufe ist jetzt die Einführung der B2B-E-Rechnungspflicht für Unternehmen in Deutschland und potenziell die Umsetzung einer E-Rechnungspflicht für innergemeinschaftliche Lieferungen in der EU. Beides verbunden mit einem zukünftigen – noch zu definierenden – Meldesystem für elektronische Rechnungen.
Das Wichtigste in Kürze
reine PDF- und Papierrechnungen werden abgeschafft (bis auf wenige Ausnahmen)
ab 1. Januar 2025 Empfangspflicht für elektronische Rechnungen gemäß EN 16931
ab 1. Januar 2027 E-Rechnungspflicht, für Unternehmen bis 800 000 € Jahresumsatz ein Jahr später
Übertragungsweg frei wählbar
bekannte Formate wie ZUGFeRD oder XRechnung können genutzt werden
Auch andere Formate sind zulässig, wenn sie steuerrechtliche Pflichtangaben in strukturierter Form beinhalten (Interoperabel mit EN 16931).
EDI-Verfahren (EDIFACT/EANCOM) weiterhin zulässig
Um die Digitalisierung von Prozessen voranzubringen, braucht es Daten, genauer gesagt strukturierte Daten, die von IT-Systemen automatisiert eingelesen und verarbeitet werden können.
Was kommt jetzt in Deutschland?
Mit dem im März 2024 verabschiedeten Wachstumschancengesetz ergeben sich weitreichende Änderungen am Umsatzsteuergesetz und damit verbunden an weiteren umsatzsteuerlichen Regelungen. Hauptziel ist die Einführung einer Verpflichtung zur Rechnungsstellung zwischen Unternehmen in strukturierter elektronischer Form.
Dies bedeutet, dass Papierrechnungen und nicht strukturierte Formate wie PDF-Rechnungen oder andere Bildformate – bis auf wenige Ausnahmen wie beispielsweise Kleinbetragsrechnungen oder Fahrausweise sowie Rechnungen an Privatpersonen (B2C) – nicht mehr zulässig sein werden. Das bisherige Anrecht auf eine Papierrechnung des Empfängers entfällt. Das bereits im Koalitionsvertrag erwähnte Meldesystem für Rechnungen ist nicht Teil des Wachstumschancengesetzes; dies ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.
Wer ist betroffen?
Die Standard-Rechnung in Deutschland ist zukünftig in einem strukturierten elektronischen Format zu erstellen, das eine automatisierte Verarbeitung ermöglicht. Dies gilt sowohl zwischen Unternehmen (B2B) als auch für Rechnungen an die öffentliche Verwaltung (B2G).
Der Gesetzgeber fordert eine breite Umsetzung der E-Rechnungspflicht, daher sind kaum Ausnahmen vorgesehen. In dem Entwurf des Schreibens des Bundesfinanzministeriums zur E-Rechnungspflicht wird klargestellt, dass auch juristische Personen des öffentlichen Rechts betroffen sind. Die Pflicht gilt für alle Organisationen, die gemäß der Definition des Umsatzsteuergesetzes als umsatzsteuerliches Unternehmen gelten. Wenn eine umsatzsteuerbare Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, greift die E-Rechnungspflicht. Betroffen sind Rechnungen in Deutschland. EU-Lieferungen und Exporte fallen nicht unter die deutsche E-Rechnungspflicht.

Rechnungsarten gemäß dem neuen Umsatzsteuergesetz
Grundsätzlich unterscheidet das neue Umsatzsteuergesetz zwischen einer elektronischen Rechnung (E-Rechnung) und sonstigen Rechnungen.
Eine E-Rechnung ist grundsätzlich in einem strukturierten elektronischen Format zu erstellen. Es gibt zwei Ausprägungen der E-Rechnung:
E-Rechnung gemäß der europäischen Norm EN 16931 (Kernrechnung)
andere Formate, die zwischen Partnern frei vereinbart werden können. Hierzu zählen insbesondere die etablierten und standardisierten EDI-/EANCOM-Formate, aber auch andere Formate bis hin zu Inhouse-Formaten bei Intercompany-Billing. Voraussetzung ist hier, dass die Pflichtangaben einer Rechnung gemäß Umsatzsteuergesetz in einem strukturierten Feld angegeben werden, die dann die Extraktion in die EN 16931 ermöglichen (Interoperabilität).
Unter dem Begriff „sonstige Rechnung“ sind alle Rechnungen gefasst, die nicht der obigen Definition entsprechen, beispielsweise Papier- und reine PDF-Rechnungen in der Übergangszeit oder bei den definierten Ausnahmen.
Welche Fristen sind relevant?
Die Einführung der E-Rechnungspflicht erfolgt schrittweise, die wichtigsten Eckpunkte sind:
1. Januar 2025
Start der Gültigkeit des neuen Umsatzsteuergesetzes verbunden mit der Empfangspflicht von E-Rechnungen für alle Unternehmen.31. Dezember 2026
Ende der allgemeinen Übergangsfrist, ab jetzt sind beispielsweise Papier- und PDF-Rechnungen nicht mehr zulässig, außer bei kleineren Unternehmen unter bestimmten Kriterien (Umsatz unter 800 000 Euro).1. Januar 2028
Ende der Übergangsfrist für kleinere Unternehmen. Deutschland ist komplett auf E-Rechnung umgestellt.
Vorteile von elektronischen Rechnungen – wie profitiert man?
Um die Digitalisierung von Prozessen voranzubringen, braucht es Daten, genauer gesagt strukturierte Daten, die von IT-Systemen automatisiert eingelesen und verarbeitet werden können. Sind unternehmensübergreifende Prozesse betroffen, kommt das Thema Standards ins Spiel, denn nur wenn die entsprechenden Standards einheitlich umgesetzt werden, profitieren alle beteiligten Geschäftspartner.
Daher sind die Datenaustauschstandards ein Kernelement bei der Umsetzung in Verbindung mit den Identifikationssystemen wie GLN (Global Location Number) und GTIN (Global Trade Item Number) sowie der automatischen Erfassung über Barcodes und Co. Vorreiter ist der EDI-Standard EANCOM®. Aber auch GS1 XML, ZUGFeRD, EPCIS (Electronic Product Code Information System) und Stammdaten (GDSN – Global Data Synchronisation Network) sind Standards für mehr Effizienz.
Im Kontext von Rechnungen bedeutet dies, dass jetzt alle Rechnungen in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung stehen. Es gibt keine „One-Size-fits-all“-Lösung bei Rechnungen. Damit alle profitieren, müssen die zugehörigen Prozesse betrachtet und die benötigten Daten für diese Prozesse festgelegt werden.
Hier greift folgendes 3-Stufen-Modell, wobei jede Stufe ihre eigene Relevanz hat:
Kernrechnung: Für die einfachen Prozesse mit wenig Digitalisierungspotenzial. Ziel ist hier, die automatisierte Erfassung und ein (teil-)automatisierter Workflow, um manuelle Prozesse zu ersetzen. Hier ist keine bilaterale Abstimmung notwendig.
Kernrechnung mit Erweiterungen: Hier wird die Kernrechnung mit weiteren Informationen erweitert, beispielweise zusätzliche Referenzen oder Zusatzinformationen auf Positionsebene, um bestimmte Prozessanforderungen zu unterstützen. Dies muss bilateral vereinbart werden. Ziel ist hier ein verbesserter automatisierter Workflow.
Branchen-/Prozess-Standards: Hier kommt das typische EDI-Szenario ins Spiel, wo ein hoher Bedarf an strukturierten Daten besteht, die in einer Community abgestimmt werden. Ziel ist es, die Prozesse vollständig zu automatisieren.
Mögliche Formate und Verfahren für elektronische Rechnungen
Die im Gesetz vorgegebenen Standardformate beruhen auf der europäischen Norm EN 16931, die die Elemente einer Kern-Rechnung und zugehörige Geschäftsregeln definiert. Die Umsetzung erfolgt dann in den XML-Formaten UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) und Universal Business Language (UBL). Die beiden Kernformate sind auch im Fokus der Empfangsverpflichtung ab 1. Januar 2025.
Zu diesen Kernformaten gibt es sogenannte CIUS (Core Invoice Usage Specification), also Subsets, beispielsweise XRechnung für Lieferanten der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Zulässig sind alle Formate, die auf der EN 16931 beruhen. Die Kernrechnung EN 16931 wurde aufgrund der B2G-Gesetzgebung für die öffentliche Verwaltung geschaffen, war aber schon immer im B2B-Bereich einsetzbar, da bei den Kernelementen keine Unterschiede bestehen.
Da die E-Rechnungspflicht ein erster Schritt in Richtung eines zukünftigen Meldesystems ist, werden weitere umsatzsteuerliche Regelungen zukünftig angepasst.
Ein weiteres Format auf Basis der EN 16931 ist ZUGFeRD/Factur-X. Dieses Format wird von den deutschen und französischen E-Rechnungsforen gepflegt. Kernidee ist, neben einem XML-Datensatz auch eine lesbare Darstellung der Rechnung zu liefern. Die XML-Rechnung wird hier in das PDF eingebettet. ZUGFeRD gibt es in verschiedenen Profilen, im Profil EN 16931 wird eins zu eins die europäische Kernrechnung abgebildet, was es voll kompatibel zur EN 16931 macht.
Wie oben erwähnt, ergeben sich bei höheren Digitalisierungsanforderungen auch höhere Anforderungen an die Inhalte der Rechnung. Seitens CEN gibt es auch eine definierte Methodologie für solche Erweiterungen. ZUGFeRD Extended ist eine solche Erweiterung (Extension) der Norm und bietet viele Felder zur Unterstützung weiterer Prozesse.
Grundprinzip ist, dass die Kernrechnung jeder verstehen sollte. Erweiterungen zur Norm oder andere Formate müssen bilateral abgestimmt werden. Es empfiehlt sich daher, mit der Kernrechnung anzufangen und dann die Szenarien schrittweise zu erweitern.
Sind bereits EDI-Verfahren im Einsatz, so können diese weitergeführt werden. Es gibt also einen gewissen Bestandsschutz für die EDI-Community. Es ist jedoch zu prüfen, ob das EDI-Verfahren die neuen Kriterien erfüllt (Interoperabilität). Auch innerbetriebliche Formate können unter diesen Bedingungen weitergeführt werden. Bezüglich des Übertragungsweges gibt es keine Vorgaben, es können also die bisherigen Verfahren genutzt werden, wobei E-Mail als Mindeststandard gilt.
Offene Fragen und Ausblick
Da die E-Rechnungspflicht ein erster Schritt in Richtung eines zukünftigen Meldesystems ist, werden weitere umsatzsteuerliche Regelungen zukünftig angepasst. Hierzu gehören Regelungen zu Sammelrechnungen, Rechnungen aus mehreren Teilen und Berichtigungsprozessen. Eine weitere Frage ist auch, ob bei EDI weiter eine ausschließliche Nutzung von Nummernsystemen (wie GLN/GTIN, aber auch Lieferantenartikelnummern) statt der laut Umsatzsteuergesetz geforderten Angaben möglich ist. Gegebenenfalls müssen hier noch bestehende Verfahren angepasst werden.
Die Nutzung der GS1-Nummernsysteme wie GLN und GTIN ist weiter erlaubt und auch in der europäischen Norm EN 16931 bereits in der Kernrechnung vorgesehen, da sie die automatisierte Verarbeitung erleichtert.
Das Thema elektronische Rechnung wird weiter im Fokus der Unternehmen und Institutionen bleiben. Für Deutschland ist, aufbauend auf der E-Rechnungsverpflichtung, ein Meldesystem geplant. Darüber hinaus plant die EU eine Richtlinie unter dem Titel „VAT in the Digital Age (ViDA)“, die für innergemeinschaftliche Lieferungen ebenfalls eine E-Rechnungspflicht und ein Meldesystem vorsieht.
Unternehmen müssen sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, da nicht nur bestimmte Prozesse betroffen sind, sondern alle Rechnungen im Eingang und im Ausgang. Somit sollten Unternehmen eine langfristige Strategie entwickeln, um von diesem Digitalisierungsschub zu profitieren.
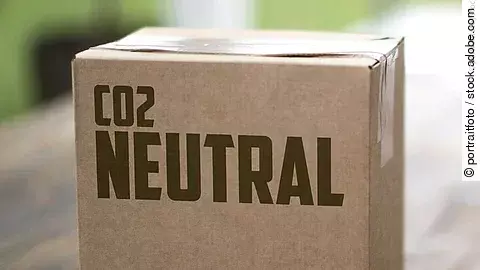


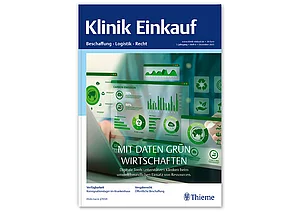
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen