
Versorgungsengpässe und Lieferkettenprobleme beschäftigten die Kliniken nicht nur zu Pandemie-Zeiten. In einer von Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff moderierten Podiumsdiskussion auf der med.Logistica wird die Stimmungslage der Beteiligten einer Lieferkette transparent gemacht, die gegenseitigen Verhaltens- und Rollenerwartungen offenbart sowie die Herausforderungen des Beschaffungsmanagements skizziert. Klinik Einkauf sprach im Vorfeld mit Prof. von Eiff.
In Ihrer Podiumsdiskussion geht es um die Resilienz von Lieferketten durch Kooperation. Aus welchem Anlass haben Sie das Thema ausgewählt?
Lieferabrisse bei Medizinprodukten und Arzneimitteln sind nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Phänomen, das die medizinische Versorgungsqualität unseres Gesundheitssystems erheblich gefährdet. Aktuell liegen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) über 450 Meldungen von Lieferengpässen bei Arzneimitteln vor: Vom Hustensaft für Kleinkinder über Blutdrucksenker und Antibiotika bis hin zu Krebsmedikamenten reicht die Meldeliste.
Auch bei Medizinprodukten ist von entspannter Marktlage nicht die Rede: Betroffen sind alle Produktkategorien von sogenannten Bagatelle-Produkten, wie Nierenschalen und Entsorgungsbeuteln über Kitpacks und Wunddrainagen bis zu Angiographiekathetern.
Welchen inhaltlichen Schwerpunkt setzt die Podiumsdiskussion?
Vor diesem Hintergrund einer zunehmenden Zahl von Versorgungsengpässen ist die Stärkung der Resilienz von Lieferketten die zentrale Herausforderung für das Beschaffungsmanagement auf Krankenhaus- und Industrieseite sowie für die Einkaufsgemeinschaften.
Im Mittelpunkt unserer Podiumsdiskussion steht die Frage, durch welche konkreten Maßnahmen die Resilienz von Lieferketten gesteigert werden kann. Da diese Herausforderung nur gemeinsam durch Anwender, Industrie und Einkaufsgemeinschaften zu bewältigen ist, wirken genau diese Akteure auf dem Podium mit.
Auf welche Ursachen sind die Lieferabrisse zurückzuführen?
Die Ursachen für Lieferabrisse sind vielfältig. Neben der Abhängigkeit von ausländischen Monopolproduzenten, der Unübersichtlichkeit globaler Lieferketten mit verlängerten Werkbänken in Schwellenländern und der Zunahme geopolitischer Auseinandersetzungen um Rohstoffe, spielt das in Deutschland praktizierte „preisorientierte Einkaufsverständnis“ eine große Rolle. Billige Produkte mögen eine ausreichende Qualität und Funktionalität bieten, wirken sich aber oft negativ aus Patientenbefinden und Prozessabläufe aus, dies zum Beispiel in Form längerer Eingriffszeiten, längerer Verweildauern und höheren Rezidivrisiken. Hinzu kommen Belastungen für Solidargemeinschaft und Krankenkassen: Kürzere Standzeiten für Implantate, beispielsweise bei Hüften und Schrittmachern, erfordern zeitlich frühere Revisionseingriffe, was das Patientenbefinden verschlechtert und gleichzeitig die Kosten im System erhöht.
Welche besonderen Erfahrungen wurden während der Pandemie im Hinblick auf die Stabilität der Versorgung gemacht?
Während der Pandemie hat sich gezeigt, dass treue Bestandskunden gerade bei Engpässen bevorzugt beliefert wurden. Von daher ist zu besprechen, wie die Liefersicherheit durch Partnerschaftsmodelle zwischen Industrie und Krankenhaus erhöht werden kann.
Wie kann aus Ihrer Sicht die Resilienz der Lieferketten konkret gesteigert werden?
Die Stärkung der Resilienz ausgewählter Lieferketten erfordert ein Bündel an aufeinander abgestimmten Maßnahmen: das betrifft das Re-Shoring systemkritischer Produkte, Komponenten und Wirkstoffe, erfordert eine Reduktion sogenannter „verlängerter Werkbänke“ in Drittländern, geht mit einer Portfolio-Bereinigung einher, betrifft die Einführung eines „Preferred Provider Management“ und setzt eine Flexibilisierung der Beschaffungsmarktstrategie voraus. Dies alles ist nur im koordinierten Zusammenspiel zwischen Anwendern, Industrie und Politik zu erreichen. Auch die Einkaufsgemeinschaften sind an dieser Stelle als Unterstützer gefragt.
Welche Denkweisen müssen sich ändern?
In diesem Zusammenhang steht auch die Frage an, inwieweit der in der Schweiz bereits praktizierte Management-Ansatz des „Value-Based Procurement“, also der „Wertorientierten Beschaffung“, dazu beitragen kann, durch Konzentration auf Medizinprodukte, die einen Mehrwert über den Funktionsnutzen hinaus bieten, die Lieferketten zu entlasten.
Dieser Ansatz erfordert allerdings ein völliges Umdenken in der Einkaufsphilosophie: Statt Einkauf ausreichender Funktionalität zu möglichst niedrigen Preisen geht es jetzt um die Beschaffung von Produkten mit Mehrwert für Patient, Anwender, Gemeinde und Umwelt.
In unserer aktuellen Studie „Monitoring Einkauf und Logistik“ haben wir die Realisierungsvoraussetzungen und die Werteffekte ausgewählter Medizinprodukte analysiert, und zwar Produkte, die in ihren jeweiligen Marktsegmenten Qualitätsführer sind.
Am Beispiel eines zirkulär scheibenförmigen Cardioform Septal Occluders zur Therapie nach kryptogenem Schlaganfall in Verbindung mit einem persistierenden Foramen ovale konnten wir demonstrieren, dass es gesundheitspolitisch, volkswirtschaftlich und bezogen auf das Patientenbefinden sinnvoll ist, dieses vergleichsweise teure Produkt einzusetzen, obwohl dies betriebswirtschaftlich für das einzelne Krankenhaus aufgrund des gegebenen Vergütungssystems von Nachteil ist.
Welche Erkenntnisse haben Sie aus Ihren Analysen gezogen?
Der Management-Ansatz „Value-Based Procurement” weist den Weg zu einer Beschaffungsphilosophie, die nicht mehr an Produktpreisen und Kosten ausgerichtet ist, sondern die Werteffekte eines Produkts für Patient, Mitarbeiter, Krankenhaus, Umwelt und Gemeinde jeder Beschaffungsentscheidung zugrunde legt.
Allerdings bedarf es zur Umsetzung des VBP-Konzepts eines neuen „wertorientierten“ Vergütungssystems, das medizinische Leistungen in evidenz-basierten Behandlungspfaden unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Opportunitätskosten vergütet. Hier ist ein weiter Weg zu gehen.
Welche Informationen können die Besucher Ihrer Podiumsdiskussion erwarten?
Die Besucher werden mit der Methodik des Managementansatzes „Value-Based Procurement“ vertraut gemacht und erhalten konkrete Informationen über die Anwendung dieses Ansatzes in der Beschaffungspraxis. Wir werden auch darüber diskutieren, welche Maßnahmen Krankenhäuser, Industrie und Einkaufsgemeinschaften konkret durchführen können, um Lieferschwierigkeiten zu begegnen. In diesem Zusammenhang geht es auch um konkrete Maßnahmen auf dem Weg zur „grünen Transformation“.


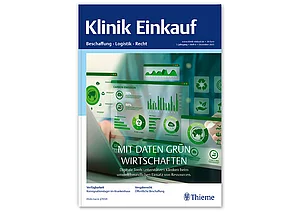
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen