
Viele Klinken haben pandemiebedingt turbulente Zeiten hinter sich. Der seit Jahren evidente Investitionsdruck sowie der Fachkräftemangel in der Pflege kamen erschwerend hinzu. Von Erholung kann auch heute keine Rede sein, denn die anhaltende Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich negativ auf die Verfügbarkeit von Medizinprodukten aus. Teilweise kommt es sogar zu Versorgungsengpässen. Auch Hersteller von Medizinprodukten beschäftigt diese Situation, möchten sie doch ihre Produkte zuverlässig zur Verfügung stellen. Neben gestörten Lieferketten, kurzfristig stark gestiegenen Rohstoffpreisen und dem hohen Inflationsdruck, machen der Medizintechnikbranche zudem neue regulatorische Anforderungen (EU-Medizinprodukteverordnung, MDR) wie auch der MDR-Drittstaat Status der Schweiz und Großbritannien zu schaffen. Gleichsam mit Herausforderungen konfrontiert, müssen sowohl Klinikbetreiber als auch Hersteller von Medizinprodukten dieser Tage Resilienz beweisen.
Strategische Partnerschaften
Aber wie? Kliniken und Medizinproduktehersteller sollten in Anbetracht der Herausforderungen durch strategische Partnerschaften ihre Kräfte besser bündeln. In volatilen Zeiten kann eine Partnerschaft für beide Seiten Planungssicherheit und Handlungsspielräume bedeuten, von denen am Ende der Patient profitiert. Der Trend hin zu einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Krankenhaus und Hersteller ist gewiss nicht neu. Anfang der 2000-Jahre rief der Harvard-Professor Michael Porter mit „Value-based Healthcare“ zu einem Qualitäts- anstelle eines Preiswettbewerbs auf, was auch den Blick auf die Beschaffung im Gesundheitswesen veränderte. Dem Value-based Healthcare-Ansatz folgend sollte nicht allein der Preis bei der Beschaffung eines Produktes die ausschlaggebende Rolle spielen, sondern vielmehr der Gesamtwertbeitrag, wie z.B. das Patientenwohlergehen. Diese Beschaffungspraktik, auch genannt „Value- based Procurement“, wurde 2014 in einer entsprechenden EU-Richtline manifestiert. Damit müssten Krankenhaus und Hersteller eng zusammenarbeiten, um gemeinsam langfristig die medizinische Qualität, wirtschaftliche Effizienz und letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der Klinik zu steigern. Jedoch konnten sich diese Partnerschaftsmodelle in Deutschland bisher nicht in der Fläche durchsetzen. Vielmehr überwiegt hierzulande immer noch das klassische Verständnis des Medizinprodukteherstellers als Zulieferer, dessen Rolle sich auf die Produktlieferung zu einem bestimmten Preis beschränkt. Ist es also Zeit, den bereits vor Jahren ausgelobten Paradigmenwechsel nun endlich zu vollziehen.
Beschaffungsvorhaben im Dialog realisieren
Einfache Beschaffungsvorhaben, bei denen nur der Preis und die Lieferung definiert werden müssen, können ad hoc erfolgen und brauchen oft wenig Vorlaufzeit. Anders sieht das bei komplexeren Vorhaben aus, bei denen Unsicherheitsfaktoren wie Lieferfähigkeit und/oder auch langfristige Ziele wie Qualitäts- oder Effizienzsteigerung mitbedacht werden müssen. Um dieser Komplexität zu begegnen, bedarf es eines frühen strategischen Austausches zwischen Klinik und Hersteller. So können Bedarfe verstanden und ein auf das Krankenhaus zugeschnittenes, lösungsorientiertes Angebot erstellt werden.
Die gemeinsame Problem- und Beschaffungsanalyse ist der Grundstein einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Klinik und Hersteller, die sich idealerweise über den gesamten Zeitraum der Umsetzung des Beschaffungsvorhabens erstreckt. In regelmäßigen Jour-fixe-Terminen können dann Änderungen besprochen und etwaige Herausforderungen im Dialog adressiert werden. Der enge Austausch sollte nicht mit der Umsetzung des Beschaffungsvorhabens aufhören, sondern eine kontinuierliche Optimierung zum Ziel haben.
Ein partnerschaftliches Beschaffungsmanagement kann auch bedeuten, Risiken gemeinsam zu schultern. Gerade in unsicheren Zeiten und mit angespanntem Budget ist der Verbrauch für Krankenhäuser nicht immer leicht abzuschätzen. Sogenannte Risk-Sharing-Modelle können helfen, dieses Risiko zu minimieren und Investitionsfehler zu vermeiden. In einem solchen Modell verständigen sich Lieferant und Kunde auf eine Zielabnahmemenge, die beispielsweise auf historischen Verbräuchen der Vorjahre basiert. Außerdem wird eine „Flatrate“ für diese Menge festgelegt. Steigt die tatsächliche Abnahmemenge um x-Prozent, bleibt der Preis gleich. Auch wenn sich die Abnahmemenge um bis zu y-Prozent reduziert, ändert sich am Preis nichts. Hersteller und Kunde teilen sich somit das Abnahmerisiko. Natürlich setzt dieses Vorgehen eine intensive Abstimmung über das Ziel-Szenario und den Umgang mit möglichen Abweichungen voraus. Besonders die Beschaffung innovativer Medizintechnik, durch die bestimmte Qualitäts- und Effizienzziele erreicht werden sollen, können auf Basis von Risk-Sharing-Modellen erleichtert werden. Hier vereinbaren Krankenhaus und Hersteller ein messbares Ziel, wie z.B. die Reduktion der nosokomialen Lungeninfektionen bei beatmeten Patienten durch bessere Mundhygiene. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, teilen sich beide Seiten die zusätzlichen Behandlungskosten.
Auch bei Investitionsgütern können Krankenhäuser über maßgeschneiderte Finanzierungsmodelle vermeintliche Risiken reduzieren und trotz finanziell herausfordernden Zeiten, ihre medizintechnische Ausstattung modernisieren. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen „On-Balance- Lösungen“, also Finanzierungsoptionen, die zur Aktivierung der Investitionsgüter in der Bilanz des Krankenhauses führen, und „Off-Balance-Lösungen“, bei denen bewusst auf die Aktivierung in der Bilanz und damit auf die Abschreibung in der Gewinn-und-Verlustrechnung verzichtet werden kann. Unter „On-Balance-Lösungen“ fallen der Kauf, Ratenkauf oder auch eine Mietvariante mit anschließender Kaufverpflichtung. Zu den „Off-Balance- Lösungen“ zählen Nutzungsverträge, bei denen die Klinik nicht Eigentümer, sondern nur Nutzer des Investitionsgutes ist. Beispiele sind Leasingverträge, Mietvereinbarungen mit Kaufoption oder Finanzierungsformen, bei denen die Beschaffung des Investitionsgutes mit der Nutzung von Verbrauchsgütern verrechnet wird. Selbstverständlich müssen bei solchen Finanzierungskonzepten – wie bei einem klassischen Kauf auch – das Vergaberecht angewendet werden.
Krisenfeste Logistik durch Partnerschaft
Sind das Beschaffungsvorhaben und das Finanzierungsmodell gemeinsam definiert, geht es an die Umsetzung. Der enge Austausch zwischen Krankenhaus und Lieferant ist hier weiterhin gefragt. Trotz der Anstrengungen seitens des Herstellers können sich gerade in Zeiten angespannter Lieferketten, Lieferdatum- und Zeitpunkt aufgrund externer Faktoren kurzfristig ändern. Beidseitige Transparenz und Flexibilität sind also wichtig, um diesen Unwegsamkeiten zu begegnen. Eine gemeinsame Mengenplanung liefert Erkenntnisse darüber, ob z.B. die geplanten Operationen des Kunden mit den vom Hersteller anvisierten Lieferterminen übereinstimmen. Cloud-basierte Planungstools können hier unterstützen und dafür sorgen, dass das Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das macht eine genaue Berechnung der für die Logistik notwendigen Teilschritte (Produktion, Transportzeiten, Einlagerung und Auslagerung) notwendig, um so möglichst exakt den Liefertermin zu bestimmen. Ergänzend dazu können durch die Reduktion von Verpackungs- und Transportkosten oder die Konsolidierung von Ware weitere Effizienzpotenziale entstehen. Kurzum: Partnerschaft, geprägt von Transparenz und proaktiver Kommunikation, fördert eine krisenfeste Logistik und sorgt dafür, dass das Beschaffungsvorhaben auch erfolgreich umgesetzt werden kann.
Hersteller als strategischer Partner: vom Produkt- zum Serviceanbieter
Krankenhäuser können über die Bereitstellung und Finanzierung des Produktes hinaus von einer strategischen Partnerschaft mit Herstellern profitieren. Beispielhaft sind an dieser Stelle Serviceangebote seitens der Hersteller zu nennen, die einen Lieferantenwechsel vereinfachen. Von Herstellern angebotene Umstellungskonzepte sorgen für einen störungsfreien Ablauf und einen nahtlosen Übergang von dem einen zum anderen Produktportfolio. Die Umstellung auf das neue Portfolio wird von einem Changemanagement-Team begleitet. Es werden maßgeschneiderte Lagerkonzepte- und Lösungen entwickelt sowie Schulungs- und Weiterbildungsprogramme angeboten. Ist das Produkt dann im Einsatz, braucht es einen verlässlichen technischen Service, der eventuelle Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum reduziert. Alle diese Serviceangebote runden den Beschaffungsprozess ab und können zusätzlich zur Versorgungssicherheit beitragen.
Versorgungssicherheit braucht Partnerschaft
In vielen Bereichen ist die Pandemie Katalysator für längst angestoßene Veränderungsprozesse. Das Gesundheitswesen ist da keine Ausnahme: Ein Paradigmenwechsel im Verhältnis zwischen Hersteller und Krankhaus sollte gerade jetzt vollzogen werden. Denn gemeinsam soll so langfristig die medizinische Qualität, wirtschaftliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit eines Krankenhauses gesteigert werden. Gerade in Anbetracht der momentanen Herausforderungen braucht es zum Wohle des Patienten ein partnerschaftliches Miteinander entlang des gesamten Beschaffungsprozesses.



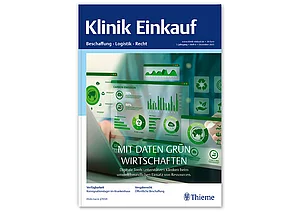
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen