
Ob zu Besuch in einer Großstadt oder als Referent auf einem Kongress, immer gilt es, Orte zu finden, Termine einzuhalten und Menschen zusammen zu führen. Gleichzeitig gilt es, unterschiedliche Interessen miteinander zu verbinden und verschiedene Emotionen zu berücksichtigen. Vergleicht man diese Situation mit dem Besuch im Krankenhaus, ob als Patient, Besucher oder Lieferant, so wird schnell deutlich, insbesondere für Patienten in besonderen Lebenssituationen und mit eingeschränkten Handlungsoptionen, ergeben sich unweit herausfordernde Aufgaben. Dies sind im Wesentlichen Orientierung und Zielführung, jedoch in der Regel ohne Touristenführer, Google Maps und Influencer-Blog. Es stellt sich daher die Aufgabe: Wie lassen sich Patientinnen und Patienten zielgerichtet, patientenorientiert und systemoptimiert zum, im und durch das Krankenhaus leiten und steuern?
Krankenhaus als zentraler Marktplatz
Bereits vor der Corona-Pandemie wirkte vielerorts ein Krankenhaus überlaufen und chaosartig. Ursachen hierfür sind u.a. die zunehmende Anzahl an ambulanten Patienten, die nach den Lockdowns wieder steigenden Besucherzahlen sowie die verstärkte Nachfrage nach stationären Gesundheitsdienstleistungen, u.a. durch die zunehmende Alterung der Gesellschaft. Diese Entwicklungen werden über anwachsendes Patientenaufkommen, erweiterte Werkzeiten und intensivierte Ressourcennutzungen (siehe ausgedehnte OP-Zeiten, verkürzte Verweildauer) aufgrund des erhöhten Durchsatzes durch das System beschleunigt.
Auf See und im Krankenhaus ist (ver)irren menschlich
Mangelnde Ortskenntnis und unzureichende Orientierung von Akteuren in einem bestehenden System führen mitunter zu zeitlichen Verzögerungen, zusätzlichen Wegstrecken sowie aufwendigen Suchaktivitäten und können zu individuellem wie systembezogenem Stress, Überlastung bis hin zum Kollaps führen. Insbesondere bei Patientinnen und Patienten können hieraus irrationales und emotionsgeladenes Verhalten resultieren. Aus Sicht der Gestaltungsverantwortlichen im Krankenhaus ergeben sich dadurch relevante Herausforderungen. Dies sind, neben der akut eingeschränkten Patientenzufriedenheit, insbesondere die Störungen durch das Verhalten der Patienten und Besucher, die entweder nicht bzw. nicht rechtzeitig am geplanten Point-of-Care erscheinen oder durch Fragen und Suchaktivitäten die Prozesse und Leistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen behindern bzw. verändern.
Orientierung über Netzplan Krankenhaus
Die Orientierung im Krankenhaus verbindet aus Patientensicht sowohl die räumlich-zeitliche als auch die inhaltlich-individuelle Verortung der eigenen Person im Rahmen der akuten Gesundheitsversorgung. Operativ und im Vorfeld der eigentlichen Gesundheitsdienstleistungen ist dabei die Fähigkeit und Möglichkeit, sich im konkreten Nahraum und bezüglich der eigenen Position zu orientieren, von zentraler Bedeutung. Hierbei sind beispielsweise Ortskenntnis, Abbildungen und Pläne in größtmöglicher Übereinstimmung mit der aktuellen Realität (z.B. auch bei baulichen Veränderungen bzw. während Umbaumaßnahmen) hilfreich. Das Spektrum möglicher Instrumente zur Unterstützung der Orientierung im Krankenhaus ist dabei vielfältig und facettenreich sowie teilweise widersprüchlich bis irreführend. Es reicht von Hinweisschildern, Piktogrammen und farblichen Wegführungen über ausdifferenzierte Lagekarten und Netzplänen bis zu Rezeptionisten und „Grünen Damen und Herren“, wobei sowohl einzeln als auch in Summe sich aus Sicht der Nutzer individuelle sowie allgemeine Lücken, Missverständnisse und Unübersichtlichkeit ergeben.
Indoor-Navigation und abstrahierte Symbole
Wohl dem, der einen Kompass hat und auch weiß diesen zu nutzen. Jedoch erweist sich dieser im Krankenhaus als wenig hilfreich, wenn auch der Verzicht auf topografische Genauigkeit in Richtung einer übersichtlicheren Gestaltung mittels farblicher Netzpläne und abstrahierte Symbole Orientierungsvorteile ermöglichen. Ziel muss es dennoch sein, die bestehenden Defizite, wie Orientierungsfragen gegenüber Health Professionals und damit Störungen und Bindung von Ressourcen sowie Verzögerungen aufgrund von Patientenabwesenheit, zu vermeiden. Vielmehr gilt es, Patienten und Besuchern die bestmögliche Route zu adressierten Stand- bzw. Zielorten über entsprechende Wege sowie Transportausprägungen (z.B. Rolltreppen, Fahrstühle) zu weisen und die Übergänge zwischen Außen- und Innenbereichen bzw. unterschiedlichen Gebäuden und Sektoren zu optimieren. Hierdurch verbessert sich nicht nur das jeweilige Patienten- und Besuchererlebnis, sondern es erhöht sich auch die Sicherheit, Hygiene und Risikominimierung sowie die Ressourceneffizienz im Krankenhaus.
Aktuelle Lösungsansätze
Bisherige Entwicklungen der übergreifenden Patientenstromgestaltung werden bestimmt durch operative Instrumente und strategische Gestaltungsansätze. Das Spektrum reicht dabei von einer Kontingentierung (z.B. Terminvergabe) sowie Ge- und Verbote (z.B. Zugangsbeschränkungen), über Information (z.B. Anmelde- und Wartebereiche) und Kommunikation (z.B. Ansprechpartner Pforte) bis hin zu baulich-technische Infrastrukturen (z.B. Gebäudeaufteilung), traditionellen Beschilderungen (z.B. taktiler Übersichtsplan) sowie technologiebasierten Indoor-Navigations-Plattformen (z.B. Wegweisungs-App). Als relevante Kriterien der Ausgestaltung derartiger Maßnahmen gelten neben Sichtbarkeit, Verständlichkeit, Intuitivität und Attraktivität der Wege, zunehmend auch die reduziert wahrgenommene Fremdbestimmung durch Verbote, Absperrungen oder offensichtliche Barrieren. Ferner gilt es, die Stärkung der Resilienz von System und Akteuren, die Reduzierung der Belastung und Sensitivität der Patienten sowie die Aufwertung des Sicherheits- und Servicegefühls auf Seiten der Patienten sicherzustellen.
Patienten- und Besucherlenkungskonzept
Nicht nur in Corona-Zeiten gilt es, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Belangen des Patienten- und Mitarbeiterschutzes sowie den Anforderungen durch die Patientenversorgung. Die Belastungen durch verstärkten Besucherdruck sowie resultierenden Anforderungen und Bedrohungen gilt es, durch patienten- und besucherlenkende Maßnahmen (z.B. Zugangskontrolle, Patientenidentifikation) unter Berücksichtigung von variierenden Nutzungsfrequenzen und besucherlenkenden Effekten (z.B. reduzierte Wartezeiten, kurze Wege) sowie auf Grundlage eines funktionierenden Patienten- und Besucherlenkungskonzepts zu berücksichtigen. Dabei sind möglichst genaue Kenntnisse über die unterschiedlichen Patienten- und Besuchergruppen (z.B. Notfallpatienten, elektive bzw. gehfähig Patienten) sowie deren Verhalten (z.B. Raucherpause, Toilettengang) in die Planungen und Maßnahmen miteinzubeziehen. In diesem Zusammenhang bietet die Corona-Pandemie auch eine Chance für einen Neustart der Patientenstromgestaltung und -lenkung im Krankenhaus.
App up die Ressourcennutzung
Für ein Post-Corona-Patientenlenkungskonzept eröffnen sich aufgrund der Möglichkeiten durch Internet- und Smartphone-Nutzung vielfältigen Ausgestaltungsoptionen und Vorteile hinsichtlich präziser Inhouse-Navigation (z.B. individuelle Real-Time-Route), transparenter Identifikations- und Kontrollfunktionen (z.B. Patientenidentifikation und -position) sowie umfangreicher Serviceausgestaltung (z.B. digitale Patientenbegleiter, Progressive-Web-App). Ferner werden die Krankenhäuser zunehmend mit immer mehr Sensoren und anspruchsvollen IKT-Systemen ausgestattet, die eine komfortable, sichere und nachhaltige Dienstleistungs- und Ressourcennutzung ermöglichen und unterstützen. Neben dem Aufbau der erforderlichen Infrastruktur, der Verbesserung der Orientierungs- und Erlebnisoptionen für Patienten und dem Monitoring der Patientenflüsse und dem Besucheraufkommen inkl. Wartezeiten, Verhaltensweisen und Bewertungen, initiieren digitale Patientenportale vielfache Optimierungspotenziale bzgl. Ressourcennutzung und Serviceausgestaltung. Digitale Patientenbegleiter bzw. App-Technologien ermöglichen dabei eine intensivierte und qualitative Kommunikation und Einbindung der Patienten, Besucher, Lieferanten und Mitarbeiter sowie sowohl eine Reduzierung der Belastung und Sensitivität als auch eine Stärkung der Resilienz von System, Prozessen und Akteuren.
Start in die digitale Transformation
Der fortlaufende und tiefgreifende Veränderungsprozess im Krankenhaus, der durch den Einsatz immer leistungsfähigerer digitaler Techniken und Technologien initiiert wird, verändert aktuell die Krankenhauslandschaft sowie die dort erbrachten Leistungen und erzielten Ergebnisse. Dabei gilt es, Patientenportale und Navi-Apps als Module und Instrumente für Kundenbindung (z.B. individualisierte Kommunikation), Co-Produktion (z.B. Daten- und Dokumentenzugriff) und Co-Design (z.B. digitale Anamnese, Terminübersicht) von werthaltigen Gesundheitsdienstleistungen zu nutzen. Diese ermöglichen neben einer räumlichen und zeitlichen Entzerrung auch die Koordination der auftretenden Patientenströme. Ferner eröffnet sich hierdurch auch eine positive Beeinflussung der psychischen und physischen Konstitution der Patienten (z.B. Entspannung, Angstreduktion, Sicherheitsgefühl) am Point-of-Care, wodurch die Versorgungsqualität steigt. Der technologische Wandel im Krankenhaus erfasst somit auch die Patientenlenkung sowie die Inhouse-Navigation und ermöglicht neben einer zielgerichteten und transparenten Patienten Journey auch die Sensibilisierung und Qualifizierung der Patienten durch eine gezielte Informationsbereitstellung und Serviceangebote. Diese Potenziale gilt es, zukünftig verstärkt zu erschließen und zu nutzen.



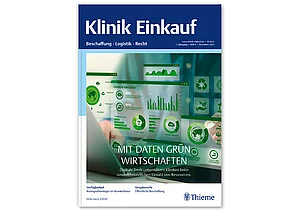
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen