
„Beide Preisträger überzeugen gleichermaßen auf sehr unterschiedlichen Gebieten, weshalb wir uns in diesem Jahr für eine zweifache Erstplatzierung entschieden haben“, erklärt Jurysprecher Prof. Dr. Hubert Otten, Leiter des Competence Centers eHealth und Professor für Technische Systeme, Betriebsorganisation und Logistik in Einrichtungen des Gesundheitswesens an der Hochschule Niederrhein. Die Preise gehen an das Universitätsklinikum Tübingen (UKT) sowie in die Schweiz an das Stadtspital Zürich.
Innovative Medizinlogistik

Das Tübinger Uniklinikum ging mit seinem Projekt „Innovative Medizinlogistik: digital, nachhaltig und mit den Menschen im Mittelpunkt“, das von 2018 bis Oktober 2022 umgesetzt wurde, an den Start. „Wir hatten in unserem Klinikum siloartige Logistikstrukturen und auch an anderen Standorten haben wir das gesehen“, beschreibt Prof. Dr. Dr. Martin Holderried, Geschäftsführer Zentralbereich Medizin, die Ausgangslage. Dies habe sich sowohl auf die Versorgungs- als auch die Unterstützungsprozesse negativ ausgewirkt.
Ein Beispiel ist der OP-Bereich, „hier ist es wichtig, dass alle Ressourcen und Informationen zur richtigen Zeit, im richtigen Kontext und bester Qualität am richtigen Ort sind“, sagt Holderried. Zahlreiche Faxe – circa 50 am Tag – und Telefonate gingen täglich zwischen OP und der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) hin und her.
Volle Transparenz dank Digitalisierung
Nun galt es, die klinischen Versorgungsprozesse, die dazugehörigen IT-Systeme und Arbeitsweisen zu harmonisieren. Voraussetzung dafür war die Angleichung der gesamten Prozess- und IT-Landschaft im Klinikum. Inzwischen sind sämtliche Prozesse rund um die OP-Versorgung einheitlich strukturiert, standardisiert, digital abgebildet und jederzeit visualisierbar, etwa auf Smartphones. Dabei kommt auch das Tracking via Bluetooth zum Einsatz. Sämtliche AWT-Wagen (AWT: Automatischer Warentransport), Speisewagen und AEMP-Wagen sind mit Sendern (sogenannten Beacons) ausgestattet – insgesamt 840 Stück. Ergänzt werden sie durch 79 Empfänger (Locatoren), etwa in Versorgungsräumen, der AWT-Anlage etc.
Auch die Siebe der Aufbereitungsanlage wurden scanfähig gemacht. „Dadurch wissen wir immer, an welchen Ort, zu welcher Zeit und in welchem Aufbereitungsstatus sich unsere Siebe befinden“, erklärt Projektleiterin Dr. Patricia Beck. Durch die Vernetzung der OP-Planung mit der im Rahmen des Projekts etablierten agilen OP-Versorgung, könne der OP-Sieb und Materialbedarf vorausschauend geplant und auf Realisierbarkeit im klinischen Alltag automatisiert geprüft werden. Ein weiterer Vorteil: Die Modellvielfalt der Instrumente wurde gemeinsam mit den klinischen Nutzern im Projekt optimiert, die Instrumentenanzahl dabei um rund 25 Prozent und das Aufbereitungsaufkommen um 15 Prozent reduziert. Und: Der nun mögliche Verzicht auf Faxe und Telefonate spart etwa 100000 Blatt Papier pro Jahr und den Mitarbeitenden viel Zeit. Mit dem Projekt werde „wird eine tolle Transparenz in allen Bereichen erzielt, bei der sich Prozesseffizienz, -geschwindigkeit sowie -qualität nutzbringend auswerten und verbessern lassen“, lobt Otten.
Doch es geht noch weiter, denn: „Stillstand ist Rückschritt“, sagt Holderried. Weiteres Optimierungspotenzial verspricht er sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im klinischen Prozessmanagement und der Logistik. Dabei soll insbesondere auch der Ansatz der nachhaltigen Logistik – „green logistic“ – verfolgt werden.
Nachtaktive Kollegen in Zürich

Krankenhäuser sind 24/7 in Betrieb – nachts sind die Ströme von Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden jedoch in der Regel geringer. In dieser Zeit kommen vier automatisierte Transportsysteme AMR (Automated Mobile Robot) am Stadtspital Zürich Triemli zum Einsatz. Zu dem Standort gehören zwei Hochhausgebäude – der Turm und das Bettenhaus – mit insgesamt 34 Etagen, die mit unterschiedlichen Gütern versorgt und deren Versorgung organisiert werden müssen.
Anlass für das Projekt war die Wiederinbetriebnahme des sanierten Turmgebäudes im Juni 2022, wodurch ein weiteres Gebäude in die bestehende Logistikinfrastruktur integriert werden musste. „Der Kostendruck im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern und somit auch in der Logistik ist hoch“, sagt Ray Müller, Projektleiter Logistik & Services des Stadtspitals Zürich. Die bestehenden Ressourcen mussten optimal genutzt werden, denn weitere Stellen standen in der Logistik nicht zur Verfügung. „Wir mussten innovativ und ideenreich sein. So sind wir auf die Ver- und Entsorgung durch autonome Transportroboter gestoßen“. Im Zusammenspiel auf Wirtschaftlichkeit und Patientensicherheit musste die Versorgung stets gewährleistet sein. Da im Turmgebäude ausschließlich Ambulatorien und Büroräume sind, sind die Voraussetzungen für den Betrieb der Roboter ideal. Ähnlich wie bei Google Maps wurde zuvor eine Karte mittels Kamera erstellt.
Pflichtbewusste Roboter
Der Prozess läuft dann so ab, dass die Kliniken ihre Artikel bis 16:00 Uhr bestellen können. Im Lager- und Logistikbereich werden diese dann kommissioniert und in den Wägen bereitgestellt. Gegen 19:15 Uhr beginnt die Schicht für die Roboter. Über jährlich insgesamt 250 Kilometer können sie sich autonom bewegen.
Mit einer Größe von 1,5 Metern Länge und 1,8 Metern Höhe (mit Wagen) kann ein einzelner Roboter 645 Kilogramm von A nach B bringen. Dabei bewegt er sich gemächlich mit 0,8 Metern pro Sekunde (knapp 3 Kilometern pro Stunde) vorwärts. Ähnlich wie ein Postbote erfüllt er pflichtbewusst seinen Dienst, beschreibt Müller. Dabei öffnet er selbstständig Türen oder ruft den Aufzug. Dazu ruft er die Transportaufträge der Liftsteuerungen ab und nutzt die Lücke, in der kein Mensch im Aufzug unterwegs ist und positioniert sich auch so, dass kein Mensch mehr mitfahren kann. Damit er nicht „mit leeren Händen“ unterwegs ist, nimmt der Roboter nach der Warenauslieferung beispielsweise Abfälle mit, die tagsüber auf extra „Parkplätzen“ in Wägen bereitgestellt werden.
Einige Mitarbeiter grüßen die Roboter sogar.
Kann der Roboter aufgrund von Hindernissen weder seine Standard- noch die Alternativroute fahren, springt der Support des Herstellers ein, der ihn mittels Kamera, Sensoren und Joystick-Steuerung aus der Situation herausmanövrieren kann. Ersetzen soll der Roboter den Menschen nicht – vielmehr die bestehende Organisation unterstützen. Mittels gezielten Kommunikationsmaßnahmen und E-Learnings wurden die Mitarbeitenden auf die neuen Kollegen vorbereitet. Und die Akzeptanz ist gut: „Einige Mitarbeiter grüßen die Roboter sogar“, erzählt Müller.
Ein hoher Anteil des Verbrauchs- wie auch Entsorgungsmaterials werden nachts mit den Robotern transportiert, was rund 8500 Transportwagen pro Jahr entspricht. „Das gab es bisher nicht, dass fahrerlose, nicht schienengebundene Transportsysteme dort aktiv sind, wo sich Patientinnen und Patienten sowie Besuchende aufhalten. Nicht zuletzt entlastet es das Personal, wenn die Roboter nun auf der Station direkt bis zum Übergabeort fahren und nicht in einem vorgelagerten Bereich, der für nicht eingewiesene Personengruppen gesperrt ist, verbleiben“, sagt Otten.



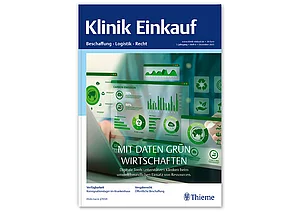
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen