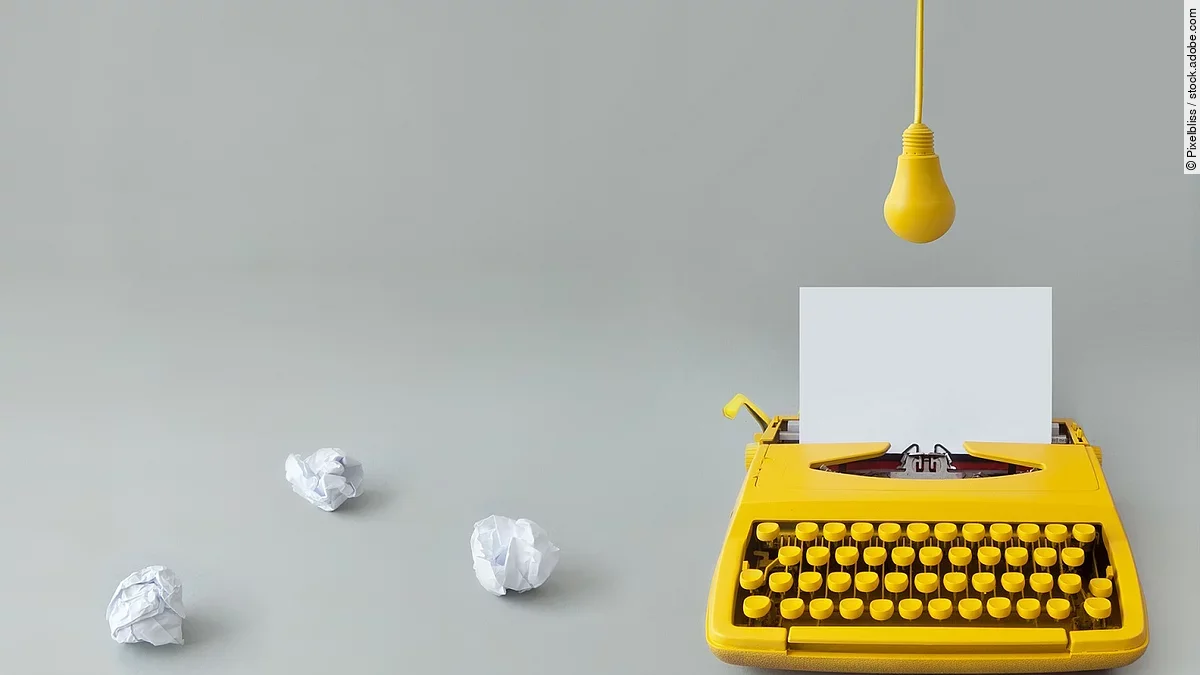
Die Krankenhauslandschaft ist geprägt vom Fachkräftemangel, Kosten- und Investitionsdruck sowie ökologischen Aspekten. Technologische Innovationen wie Digitalisierung und Robotik verändern die Strukturen und Prozesse. In einer zweiteiligen Serie werden ausgewählte Themen aus dem Buch „Das Krankenhaus der Zukunft“ vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML vorgestellt.
Die übergeordneten Themengebiete Stationslogistik, OP-Logistik und Transportlogistik werden hierbei zunächst im Hinblick auf Best Practices im Jahr 2025 beleuchtet, um im zweiten Teil einen perspektivischen Ausblick auf das Jahr 2035 zu geben.
Stationslogistik
Insbesondere im Stationsalltag ist eine Entlastung der Pflegefachpersonen bereits heute durch Automatisierungslösungen, z. B. in Form eines Modulschranksystems mit intelligenter Materialanforderung, möglich. Aber auch in patientennahen Bereichen halten innovative Konzepte zunehmend Einzug.
Eine Entlastung des Wartebereichs kann über den Einsatz eines Wartendenmanagements erreicht werden. Die Smartphones der Patienten werden bei der Anmeldung temporär mit dem Termin gekoppelt, sodass Termininformationen jederzeit an den Patienten gesendet werden können. Auf diese Weise müssen Patienten nicht im Wartebereich bis zum Termin warten, sondern können ihre Wartezeit anderweitig füllen, wie zum Beispiel durch einen Spaziergang auf dem Campus. Das Personal steuert systemseitig die Smartphones an und informiert die Patienten über den weiteren Untersuchungsverlauf. Sie erhalten zum Beispiel die Zeit, die Raumnummer und gegebenenfalls den Weg zum Untersuchungsraum im Rahmen einer Campusnavigation. Die flexible Gestaltung der Wartezeit führt zu einem angenehmeren Aufenthalt und bietet gleichzeitig eine vertrauliche Verständigung zwischen dem Personal und den Patienten, indem Patientennamen nicht aufgerufen oder auf Bildschirmen angezeigt werden müssen.
Die Implementierung einer Same-Day-Aufnahme von Patienten sowie einer Entlasslounge entlasten die Pflegestationen. Dadurch entsteht konzentriert am Morgen die Aufbereitungsnachfrage der Patientenbetten. Zudem müssen die aufbereiteten Patientenbetten nicht mehr nur auf Station, sondern auch in OP- und Untersuchungsbereichen zur Verfügung gestellt werden. Die Veränderung der Betriebsorganisationskonzepte hat somit direkte Auswirkungen auf die Logistik leerer Patientenbetten sowie der Aufbereitungskapazitäten. Insbesondere bei der Konzeptionierung von automatisierten Aufbereitungseinheiten sowie den jeweils angegliederten Pufferbereichen (rein / unrein) ist das konzentrierte Zeitfenster der anfallenden Patientenbetten zu berücksichtigen. Durch die veränderten Betriebskonzepte in Kombination mit dem darauf angepassten Bettenmanagement, in Form von Transporten und automatisierten Aufbereitungseinheiten, kann eine höhere Bettenauslastung erzielt werden.
OP-Logistik
Hoher Personal- und Materialaufwand sowie die eingesetzte Technik im OP-Bereich machen diesen zu einem der komplexesten und kostenintensivsten Bereiche im Krankenhaus. Gleichzeitig fordert beispielsweise der Fachkräftemangel zunehmend standardisierte und personalentlastende Prozesse.
Ein ganzheitliches Fallwagenkonzept ermöglicht eine zeitliche und räumliche Verlagerung der Vorbereitungsprozesse einer Operation. Die räumlichen Gegebenheiten und zeitlich definierten Prozessschritte bilden hierbei die Rahmenbedingungen des Konzepts. Um über die operationsspezifischen Materialien zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu verfügen, sind standardisierte Material-Listen und systemseitige Verknüpfungen mit dem OP-Plan notwendig. Darüber hinaus wird durch den Einsatz von Versorgungsassistenten der Kommissionierprozess von den Aufgaben der OP-Pflegefachkraft entkoppelt. Eine Fallwagensoftware unterstützt die Versorgungsassistenten bei der Zusammenstellung der richtigen Materialien in einer wegeoptimierten Reihenfolge auf dem Fallwagen. Durch die Implementierung eines Fallwagenkonzepts wird eine Entlastung des OP-Pflegefachpersonals ermöglicht. Zudem gewährleisten die definierten Materialstandards mehr Transparenz, Standardisierung und höhere Stabilität in den Prozessen.
Eine echtzeitbasierte Optimierung des OP-Plans liefert für die kurz- bis mittelfristige Planung im OP-Bereich auf Knopfdruck einen optimalen Vorschlag. Eine Softwarelösung erhöht hierbei nicht nur die Qualität und Stabilität des OP-Plans, sondern identifiziert auch frühzeitig freie Kapazitäten und erleichtert die Koordination von räumlichen, technischen und personellen Ressourcen im OP-Bereich. Dadurch wird die Effizienz im OP-Bereich gesteigert.
Transportlogistik
Eine der originären Aufgaben der Krankenhauslogistik ist der Transport von Gütern innerhalb des Krankenhauses. Zentrale Herausforderungen sind hierbei die Varianz der Transportanforderungen durch die Vielzahl an Strömen sowie der Anspruch an eine möglichst unauffällige Logistik. Dabei bieten Digitalisierung und Automatisierung Möglichkeiten, um die Transportlogistik im Krankenhaus zu optimieren.
Für die Transportlogistik im Krankenhaus stehen verschiedene technologische Systeme, wie die Rohrpost, Drohnen und Transportroboter zur Verfügung. Es gilt, ein Netzwerk aus unterschiedlichen Quell- und Zielpunkten mit variablen Rahmenbedingungen zuverlässig miteinander zu verbinden. Das Spektrum an Transportaufgaben umfasst sowohl Regeltransporte in festgelegten Zeiträumen als auch Ad-hoc-Transportanforderungen. Dabei reicht die Spannweite der zu transportierenden Objekten von kleinen Laborproben über standardisierte Kleinladungsträger bis hin zu großen Entsorgungsbehältern oder Patientenbetten. Insbesondere zur Unterstützung der krankenhausinternen Transportprozesse nimmt die Anzahl an automatisierten Transporten, beispielsweise durch fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter, stetig zu – auch, um den Auswirkungen des Fachkräftemangels entgegenzuwirken. Für die Auswahl der richtigen Automatisierungstechnik müssen die Infrastruktur und die Transportprozesse betrachtet werden.
Die Sendungsverfolgung ermöglicht in der Intralogistik eine Verfolgung und Rückverfolgung von Warensendungen zwischen dem Absende- und Empfangsort. Bei dem Durchlaufen von Gates (Checkpoints) werden der jeweiligen Warensendung der exakte Ort und die Zeit im Versandprozess zugeschrieben und im System hinterlegt. Auf diese Weise ist sowohl für den Versender als auch für den Empfänger der Status einer jeweiligen Sendung im System einsehbar. Durch die Sendungsverfolgung wird eine hohe Transparenz über den Sendungsstatus erzeugt. Die Sendungsverfolgung unterstützt zudem auf Basis der Sendungshistorie bei der Ermittlung zum Verbleib einer Sendung, wenn die Sendung ihr Ziel nicht erreicht hat. Ebenso werden Bewegungsdaten erzeugt und gespeichert, die eine aussagekräftige Basis zur Optimierung von Prozessen und Warenbewegungen darstellen können. Die Sendungsverfolgung ermöglicht in der Intralogistik eine Verfolgung und Rückverfolgung von Warensendungen zwischen dem Absende- und Empfangsort.

Dr.-Ing. Sebastian Wibbeling (Hrsg.), Malin Gerhardt (Hrsg.)
Das Krankenhaus der Zukunft Von der Gegenwart in die Zukunft
2. Auflage
97 Seiten
ISBN: 978–3-8396–2062–5
Preis: 129,00 (D) Euro
Quelle: Fraunhofer IML
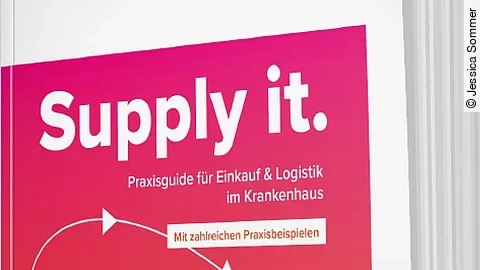


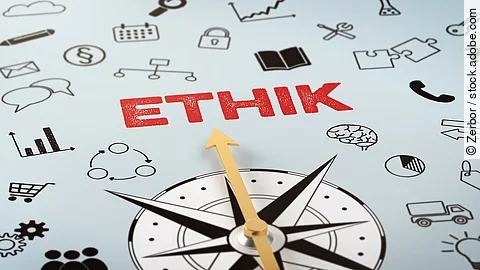
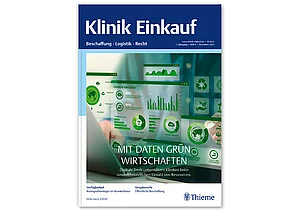
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen