
Es geht beim Framing um das geschickte Kreieren eines inhaltlichen „Rahmens“, in dem sich in der Folgezeit Diskussionen in Verhandlungen bewegen. Das Wissen darum lässt sich aktiv und passiv einsetzen. Wenn es in einer Preisverhandlung im Einkauf um Güter geht, die in gleicher oder ähnlicher Weise zuvor schon einmal gekauft wurden, haben beide Seiten üblicherweise eine bestimmte Erwartungshaltung in Bezug auf die Einkaufskonditionen, und die sind oft nicht sehr weit auseinander.
Besonders spannend sind aber die Konstellationen, bei denen es um sehr innovative Güter oder auch neuartige Dienstleistungen geht und Einkäufer und Verkäufer sich möglicherweise das erste Mal gegenübersitzen. Dann stellt sich für beide Seiten die magische Frage, wer, wann, welches erste Angebot abgibt.
Die Literatur bietet dafür zwei unterschiedliche Varianten an, die allerdings zunächst widersprüchliche Empfehlungen geben.
Variante A (Das Mikado-Spiel)
Insbesondere (unseriöse) Verkäufer drängen die Gegenseite dazu, ein erstes Angebot abzugeben. Dies wird dann aber mit einer aggressiven Gegenforderung gekontert, um sich schließlich in der Mitte zu treffen.
Beispiel: Ein Strandhändler offeriert Sonnenhüte. Sie könnten sich durchaus einen Kauf vorstellen, wenn der Preis stimmt. Anfänglich wären Sie bereit, maximal 10 Euro zu bezahlen. Sie bieten daher im ersten Schritt 6 Euro an und erliegen der Illusion, vor einem extra guten Deal zu stehen. Der Verkäufer allerdings erklärt das mit gespieltem Entsetzen für ruinös und fordert 20 Euro. Nach kurzem Feilschen treffen Sie sich in der Mitte, also 13 Euro. Das Ausnutzen Ihrer natürlichen Sehnsucht nach einem fairen „Treffen in der Mitte“ hat Sie also dazu gebracht, 3 Euro mehr zu bezahlen, als Sie eigentlich wollten. Wie beim Mikado-Spiel haben Sie als derjenige, der sich zuerst bewegt hat, verloren.
Das Ausnutzen Ihrer natürlichen Sehnsucht nach einem fairen „Treffen in der Mitte“ hat Sie also dazu gebracht, 3 Euro mehr zu bezahlen.
Dieses hälftige Aufteilen der Differenz zwischen den Forderungen von Käufer und Verkäufer ist mannigfach durch spieltheoretische Experimente belegt worden und gilt auch bei Praktikern als der übliche Weg zu einem fairen Kompromiss. Das ist auch grundsätzlich völlig okay. Das obige Beispiel zeigt aber, dass dieses weithin akzeptierte Finden einer fairen Lösung missbräuchlich verwendet werden kann. Seien Sie also immer dann vorsichtig, wenn Sie das erste Angebot abgeben sollen.
Variante B (Anker setzen oder Framing)
Hier ist der Mechanismus komplett anders. Eine Seite prescht aktiv mit einem aggressiven Angebot vor und bringt sich dadurch in eine führende Position. Oft kommt das dann noch in Kombination mit einer Begründung und als krumme Zahl, weil das Präzision suggerieren soll. Mit einem solchen ersten Anker wird die weitere Diskussion in eine bestimmte Richtung gelenkt, es entsteht also ein „Rahmen“ (frame), aus dem die Gegenseite nur schwer ausbrechen kann.
Beispiel für die Macht des Unterbewusstseins beim Framing: In der Literatur wird von einem Experiment berichtet, das sinngemäß wie folgt abgelaufen ist. 100 Personen wurde jeweils die gleiche Frage gestellt, die nicht besonders lebensrelevant ist und üblicherweise auch von niemandem kompetent beantwortet werden kann. Die Probanden sollten einfach raten, wie viele Haare menschliche Augenbrauen haben. Nehmen wir an, eine korrekte Antwort wäre zwischen 200 und 300.
In diesem Experiment wurden nun zwei Gruppen zu je 50 Personen formiert. Die einen bekamen die Frage direkt gestellt, die anderen wurden zuvor gebeten, an einem Glücksrad zu drehen. Die möglichen Werte auf diesem Glücksrad lagen zwischen 500 und 1000. Das Ergebnis war verblüffend: Die Personen mit der Glücksradziehung nannten signifikant höhere Werte auf die Frage nach der Zahl der Haare der menschlichen Augenbrauen als die Kontrollgruppe.
Am besten ist es, die Zahl zunächst zu ignorieren, inhaltlich weiter zu verhandeln und nach einer gewissen Zeit einen Gegenanker zu setzen.
Obwohl jedem klar war, dass das Glücksrad wirklich gar nichts mit der eigentlichen Frage zu tun hat, wirkte der Anker im Unterbewusstsein. Wer in einer Einkaufsverhandlung mit einem aggressiven Anker vorangeht, will sich diesen Effekt zunutze machen. Der Gegenseite bleiben allerdings einige Optionen. Zunächst ist es wichtig, die genannte Zahl nicht noch zu wiederholen, dann wird sie sozusagen „eingeloggt“. Am besten ist es, die Zahl zunächst zu ignorieren, inhaltlich weiter zu verhandeln und nach einer gewissen Zeit einen Gegenanker zu setzen. Wenn beide Seiten ernsthaft an einem Deal interessiert sind, bestehen durchaus Möglichkeiten zu einer Einigung, bei der keine der beiden Seiten ihr Gesicht verliert.
Framing mit Begriffen
| Kategorie | Monumental | Machbar | Mytersiös |
|---|---|---|---|
| Grundprinzip | Aufmerksamkeit erzeugen | Aufteilen einer komplexen Aufgabe in kleine, schaffbare erste Schritte | Unsicherheit und Neugier erzeugen |
| Beispiele für Begriffe | Lasst uns Geschichte schreiben, alles, jeder, global, episch, ewig, existenziell, Revolution, Wunsch, Überleben, lasst und die Welt verändern ... | Hol es dir, Hack, sofort, Minute, Moment, Lösung, wie es funktioniert, Hilfe, zusammen, wir ... | Neu, plötzlich, Eilmeldung, geheim, enthüllen, entlarven, Innovation, verborgen, unsichtbar, Mythos, Überraschung, Magie, Stimmung ... |
Framing mit Zahlen (Anker setzen) ist ein machtvolles Instrument, Framing kann aber auch mit Worten passieren. Insbesondere in dem universellen Aufmerksamkeitswettbewerb im Internet wird reichlich davon Gebrauch gemacht. Wer sich ein wenig in sozialen Medien bewegt, erkennt schnell, dass es im Prinzip drei grundsätzliche Varianten gibt (siehe Tabelle oben). Diese wirken naturgemäß besonders machtvoll, wenn sie in Kombination auftreten.
Warum geht von diesen (und natürlich vielen anderen) Begriffen so eine mächtige Wirkung aus? Vielleicht halten Sie sich für immun, weil wir alle jeden Tag unzählige Male mit diesen Formulierungen traktiert werden. Dann spielen Sie mit sich selbst ein kleines Beispiel: Denken Sie für eine Minute nicht an einen Elefanten! Sie merken sofort, dass das nicht geht. Das Rüsseltier geistert unausweichlich durch Ihren Kopf. In der Psychologie wird dies als „unbeabsichtigte Blindheit“ bezeichnet. Eine geschickte Auswahl von Formulierungen (wie in der Tabelle) manipuliert unbemerkt das menschliche Denken.
Das Framing mit Worten lässt sich insbesondere mit Beispielen aus der schillernden Welt des Internetmarketings erläutern. Aber auch in seriösen Einkaufsverhandlungen kann es passieren, dass die Gegenseite in diese Toolbox greift.
Den Mechanismus des Framings verinnerlichen
Framing ist allgegenwärtig in Diskussionen. Ein Frame kann die Denkweise der Gegenseite so beeinflussen, dass es leichter wird, die eigenen Ziele durchzusetzen. Allerdings können viele Frames auch „gedreht“ und gegen den Urheber gerichtet werden.
Ein Frame kann die Denkweise der Gegenseite so beeinflussen, dass es leichter wird, die eigenen Ziele durchzusetzen.
Wenn der Verkäufer etwa darauf pocht, die technische Innovation seines Produktes zum Thema machen zu wollen, der Käufer aber nachweislich davon mehr versteht, kann „der Schuss“ für den Verkäufer „nach hinten losgehen“. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, den Mechanismus des Framings zu verinnerlichen und ihn zu einem festen Bestandteil von Verhandlungsvorbereitungen zu machen.

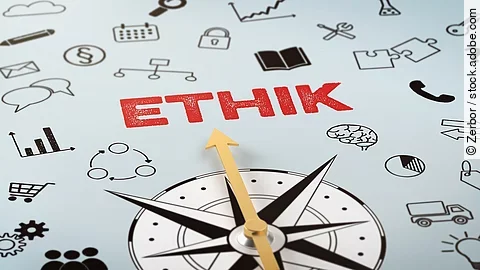



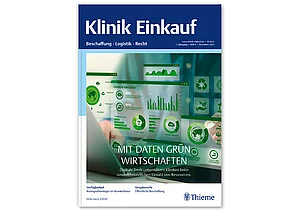
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen